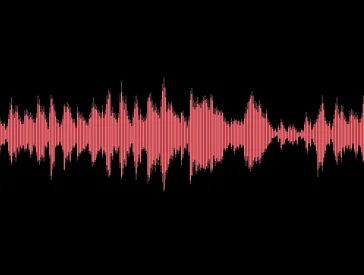145 Porzellanschilder – und das Foto, mit dem die Recherche nach ihrer Herkunft begann; privat
Berliner Banknachbarn
Eine ungewöhnliche Spurensuche
Wie kommt ein Eimer mit Porzellanschildern tief unter die Erde, zwischen die Wurzeln eines Baumes im Norden von Berlin? Warum werden die Schilder dem Jüdischen Museum Berlin übergeben? Wie viele Fachleute benötigt man, um dieses Rätsel aufzulösen? Eine ungewöhnliche Spurensuche.
Im Jahr 2020 stieß der Inhaber einer Gartenbaufirma im Außenbereich einer Berliner Kita auf die Reste eines Blecheimers mit 145 Namensschildern aus Porzellan. Er nahm sie zunächst zur Verwahrung an sich. Seiner Ehefrau fiel auf, dass sich auf zweien dieser Schilder der Nachname Brasch befand, einmal Joseph und einmal Leo Brasch. Es waren Namen, die sie aus dem Kino kannte, aus einem Film über die jüdische Familie Brasch. Könnten Leo und Joseph Mitglieder dieser Familie sein?
Das Ehepaar wandte sich an das Jüdische Museum Berlin und bot den Fund dem Archiv an. Auf den zunächst vorgelegten Fotos war Folgendes zu erkennen: Abgerundete weiße Schilder mit Löchern links und rechts, die also ursprünglich angeschraubt waren. Namen von Personen, aber auch von Firmen und Banken, waren in unterschiedlichen Schrifttypen darauf erkennbar. Die Gestaltung der Schilder legte nahe, dass sie um 1900 hergestellt worden waren. Der Sammlungsbereich des JMB beschloss, herauszufinden, wozu die Namensschilder dienten und woher sie stammten, bevor sie aufgenommen werden könnten.
Die naheliegendste Vermutung, dass es sich um Türschilder aus der Nachbarschaft der Fundstelle handeln könnte, ließ sich anhand Berliner Adressbücher am schnellsten prüfen: Stichprobenhaft suchten wir in jenen aus den Jahren 1900, 1913, 1923 und zogen auch das Jüdische Adressbuch von 1930 zu Rate, da nicht nur der Name Brasch, sondern auch weitere Namen auf eine potentiell jüdische Familie hindeuteten. Die Recherche ergab, dass in keinem Jahr alle Namen gleichzeitig zu finden waren; zudem waren die Adressen jener Firmen und Personen, die verzeichnet waren, in keinem Fall identisch.
Einige Namensschilder aus dem Fund deuten auf eine potentiell jüdische Familie hin. Jüdisches Museum Berlin, Foto: Roman März
Die Adressbücher brachten uns jedoch auf eine neue Fährte: Alle aufgefundenen Personen standen als „Kaufmann“ oder „Bankier“ im Adressbuch. Das ließ vermuten, dass alle eine ähnliche Tätigkeit ausübten und sie einem möglicherweise wohlhabenden Milieu angehörten. Wurden die Schilder vielleicht in einem Verein genutzt, etwa zur Personalisierung eines Spinds oder Postfachs? Einige der Namen fanden sich auf einer Mitgliederliste des Vereins Die Gesellschaft der Freunde wieder.1 Das half bei der Zuordnung der übrigen Namen aber nicht weiter.
Waren es vielleicht Namensschilder von Sitzplätzen in einer Synagoge? Auch diese Hypothese konnte schnell verworfen werden, denn wieso hätte etwa der Protestant Albert Schappach, dessen Privatbank ebenfalls eines der Schilder ziert, einen beschilderten Sitz in der Synagoge haben sollen? Also doch ein Verein? Die Suche nach passenden Gruppen wurde abgebrochen, weil eine Eingrenzung unter den Hunderten Vereinen Berlins nicht möglich war. Wo also hätte man solche Schilder sonst noch anschrauben können? Vielleicht im Theater oder in der Oper als Zeichen sogenannter Stuhlpatenschaften, wie es sie heute noch gibt?
Ein Gespräch mit der Theaterwissenschaftlerin Ruth Freydank, die viele Jahre im Märkischen Museum, dem Stadtmuseum Berlins, tätig war, ergab, dass zwei kulturelle Einrichtungen mit großer bürgerschaftlicher Finanzierung in Frage kämen: Erstens der Vorgängerbau der Deutschen Oper und zweitens das Schillertheater. Das Archiv des Schillertheaters ist jedoch verbrannt, und der Bau an sich wurde von Frau Freydank selbst bereits in seiner Tiefe erforscht – ein Hinweis auf Porzellanschilder tauchte dort in keinem Zusammenhang auf. Der Vorgängerbau der Deutschen Oper wiederum wurde im Jahr 1913 realisiert. Allerdings war etwa der Bankier Alwin Abrahamsohn, dessen Name sich auf einem der Schilder befindet, bereits 1902 verstorben; als Zeichen einer Stuhlpatenschaft in diesem Bau konnten die Schilder also nicht gedient haben.
Auch die Privatbank des Protestanten Albert Schappach ziert eines der Schilder. Jüdisches Museum Berlin, Foto: Roman März
Im nächsten Schritt wurden die Schilder selbst noch einmal genau unter die Lupe genommen. Ganz bewusst hatten die Finder Erde und Sand auf den Schildern belassen, um den Zustand beim Fund zu bewahren. Das vorsichtige Säubern einzelner Schilder legte in einigen Fällen eine rückseitige Pressmarke der Porzellan-Manufaktur LHA Schmidt-Berlin Moabit frei. Glücklicherweise ist die Sammlung der Moabiter Porzellane des Märkischen Museums online zugänglich, darunter auch Stücke aus Schmidt-Porzellan. Ebenfalls genannt ist ihr Stifter, ein Nachfahre der Firmengründer, der den Namen Buschenhagen trägt. Er antwortete auf die Anfrage im Kontaktformular seiner Druckerei, ob er der Porzellan-Stifter sei, prompt, ja, das sei er, und schickte noch seine „Porzellanadresse“, über die er in diesem Falle besser zu kontaktieren sei. Herr Buschenhagen und seine Frau waren begeistert von der Fragestellung nach dem Zweck der Schilder und schlossen sich der Recherche an. Der Porzellanexperte kannte die vorliegenden Schilder selbst nicht, konnte jedoch erkennen, dass es sich um eine Sonderanfertigung handelte, so wie z.B. die Schilder im Botanischen Garten zur Bezeichnung unterschiedlicher Pflanzen.
Den entscheidenden Hinweis lieferte indes seine Frau: Legt die Kombination aus Firmen, Bankiers und Kaufleuten nicht nahe, dass die Schilder aus der Berliner Börse stammen? Tatsächlich konnte der in den verschiedenen Adressbüchern angegebene Beruf Kaufmann mit Hilfe des Handels-Registers spezifiziert werden; es zeigte sich, dass alle Namensträger Berufen nachgingen, die an der Börse aktiv waren, darunter Getreidehändler2, wie etwa die Brüder Joseph und Leo Brasch, oder Börsenmakler. Zur Berliner Börse ist bereits geforscht worden, unter anderem von Christof Biggeleben, der sich intensiv mit der Korporation der Kaufmannschaft, also der Leitung der Börse beschäftigt hat.3
Die Börse in Berlin mit der 1892/93 erweiterten Friedrichsbrücke, 1901; Landesarchiv Berlin, F Rep. 290 Nr. II3343 / Foto: Waldemar Titzenthaler
Während eines Telefonats vermutete er, dass die Schilder die Orte markierten, an denen die Firmen bzw. Händler standen; damit lag er fast richtig. Die endgültige Lösung schließlich kannte Katrin Richter, die zum Thema Die Medien der Börse4 promoviert wurde, und uns Bilder der Börse zeigen konnte: Auf mehreren Zeichnungen, Gemälden und Fotos sind eindeutig weiße Schilder an den Sitzbänken zu erkennen. Außerdem kannte sie die Beschreibung des Publizisten und Reiseschriftstellers Georg Schweizer, der 1891 berichtete: „Jene Nischen zwischen den Säulen entlang den Wänden des Saals […] sind zu ganz ansehnlichen Preisen an die großen Firmen vermiethet, und dort lassen sich deren Vertreter allmittags nieder. Ueberhaupt gibt es keinen Platz auf den zweisitzigen Bänken mit der gemeinschaftlichen Mittellehne oder auf den Subsellien [= Sitzbänke] am Fuße der Säulen, welcher nicht für ein hübsches Sümmchen einem bestimmten Hause reserviert wäre. Die kleinen, weißen Porzellanschilder auf beiden Seiten der Rückenlehne tragen die Namen der Miether.“5
Doch wie geriet der Eimer mit den Porzellanschildern unter den Baum im Garten der Berliner Kita? Laut dem Inhaber der Gartenbaufirma und Finder weist das Wurzelwachstum des Baums auf einen Vergrabungszeitpunkt vor 70 bis 80 Jahren hin – also zwischen 1940 und 1950. Vielleicht sind die Schilder von jemandem vergraben worden, der sie für bedeutsam hielt. Vielleicht war es eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Berliner Börse, der sie vor den Bombenangriffen retten wollte?
Wie dem auch sei: Heute gelten die Schilder als „herrenlose Funde“, und ihre Eigentümerin ist das Land Berlin, das sie dem Jüdischen Museum Berlin als Dauerleihgaben überlassen hat. Auch wenn es insgesamt wohl über tausend solcher Namensschilder in der Börse gegeben hat, können wir von Glück sagen, dass zumindest ein Teil dieser materiellen Überreste der Berliner Börse die Zeiten überdauert hat und nun der historischen Forschung zur Verfügung steht.
Lea Simon
Lea Simon ist seit Mai 2022 wissenschaftliche Volontärin im Jüdischen Museum Berlin. Sie studierte Musikwissenschaft und Romanistik in Heidelberg, Tours und Weimar und verteidigte ihre Dissertation zum Thema Klassische Komponisten in Kibbuzim der 1930er- bis 1980er-Jahre an der Universität der Künste Berlin.
Der Beitrag erschien 2023 in der gedruckten Ausgabe des JMB Journals #25.
Zitierempfehlung:
Lea Simon (2023), Berliner Banknachbarn. Eine ungewöhnliche Spurensuche.
URL: www.jmberlin.de/node/10133
- Sebastian Panwitz, Die Gesellschaft der Freunde 1792–1935. Berliner Juden zwischen Aufklärung und Hochfinanz, Hildesheim: Georg Olms, 2007.↩︎
- Getreidehändler war deshalb passend, weil es einen Saal für den Lebensmittelhandel, die sogenannte, Produktenbörse gab. ↩︎
- Christof Biggeleben, Das Bollwerk des Bürgertums. Die Berliner Kaufmannschaft 1870–1920, München 2006. ↩︎
- Katrin Richter, Die Medien der Börse. Eine Wissensgeschichte der Berliner Börse von 1860 bis 1933, Berlin 2020.↩︎
- Georg Schweitzer, Berliner Börse, in: M. Reymond, L. Manzel (Hg.): Berliner Pflaster. Illustrierte Schilderungen aus dem Berliner Leben, Berlin 1891, S. 324f.↩︎