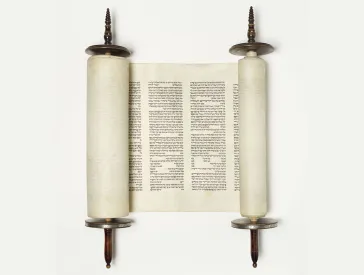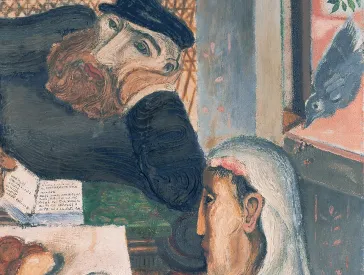Maria und Natalia Petschatnikov (*1973, Leningrad, Sowjetunion, heute: St. Petersburg, Russland), SPATZEN, Acrystal, 2014; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.
Spatzen, 4 Euro und die Stoffe der Stadt
Ende Mai 2015 gab es endlich die ersten fühlbaren Sonnenstrahlen in Berlin und damit eine perfekte Gelegenheit für mich, einen Ausflug nach Kreuzberg zu machen. Die Künstlerinnen Maria und Natalia Petschatnikov zeigten mir ihr Atelier und erzählten mir von den Spatzen und 4 Euro, ihren beiden Objekten im Kunstautomaten des Jüdischen Museums Berlin. Sie sprachen über ihre aktuellen Projekte und beantworteten mit viel Humor auch alle meine Fragen jenseits von Kunst.
Michaela Roßberg: Ihr arbeitet immer zusammen und seid Zwillinge, sogar eineiige. Wie ist es, wenn man so eng miteinander arbeitet? Wie entwickeln sich dabei Ideen und die Arbeit an Projekten? Schließlich hat doch immer nur eine Person das Idealbild eines fertigen Werkes vor Augen, oder?
Maria: Bei uns geschieht viel durch Dialog. Es ist nicht so, dass eine von uns die Idee hat und nach der Fertigstellung des Projekts sagen kann: Das ist meine Idee gewesen
. Bei uns entstehen Arbeiten in einem gemeinsamen Prozess, wir gehen z.B. zusammen durch die Stadt und sehen interessante Dinge, die uns zum Nachdenken anregen. Wir sprechen viel über diese Sachen und daraus entstehen dann unsere gemeinsamen Ideen.
Natalia: Wir beschäftigen uns häufig mit der urbanen Umwelt. Weil wir viel zusammen beobachten, haben viele unserer Arbeiten die sogenannten kleinen Dinge des Alltags, wie Tiere oder den öffentlichen Nahverkehr, zum Thema.
Michaela Roßberg: Was habt ihr gedacht, als das Jüdische Museum Berlin mit der Idee auf euch zugekommen ist, sich an der neuen Reihe des Kunstautomaten zu beteiligen? Warum habt ihr euch dafür entschieden mitzumachen?
Natalia: Zunächst hatten wir großen Respekt vor der Institution des Museums. Aber das Projekt gibt uns die Möglichkeit, etwas über uns und unsere Arbeit zu erzählen. Wir haben 400 Objekte für den Automaten angefertigt, das bedeutet, dass wir vielleicht 400 Leute mit unserer Kunst erreichen. Dieses Gefühl, mit der eigenen Arbeit Menschen zu erreichen, ist für Künstler*innen sehr wichtig.
Maria: Wir finden die Idee auch einfach sehr gut. Kunst ist oft elitär: Wir können uns die Arbeiten unserer Freunde nicht leisten, die können sich unsere nicht leisten. Das Tolle am Kunstautomaten ist, dass er eine schöne Brücke zwischen der Kunst und den Museumsbesuchern baut. Wir machen auch keinen Unterschied zwischen einer Arbeit für vier Euro oder 400 Euro, sondern arbeiten mit der gleichen Mühe daran. Uns hat zudem die Wertschätzung und der Respekt uns Künstlerinnen gegenüber gefreut, und wie viel Mühe sich die zuständigen Personen gemacht haben, obwohl die Werke nur 4 Euro pro Stück kosten.
Michaela Roßberg: Normalerweise fertigt man ja auch nur ein oder wenige Stücke eines Objekts an und nicht 200, wie für den Kunstautomaten. Frustriert diese Menge einen nicht irgendwann?
Natalia: Ganz im Gegenteil. Gerade durch das Arbeiten an mehreren Werken des gleichen Typs ändert sich dein Bezug zum Werk, du fängst an, damit zu spielen, du erlebst es anders.
Michaela Roßberg: Auch beim 150sten Mal? (Beide lachen)
Maria: Bei den Spatzen für den Kunstautomaten ging es ganz gut, denn die haben wir ja gegossen. Sie haben auch viel Arbeit gemacht, aber nicht so viel wie die Bilder. Aber gerade die 4 Euro-Bilder haben wir ja aus einem bestimmten Grund gemalt, sie haben eine konzeptuelle Ebene. Es ist für uns wie ein Kommentar dazu, was gerade in unserer Branche passiert. Wer entscheidet, was Gemälde oder Kunstobjekte wert sind? Wer entscheidet über die Schätzung?
Natalia: So bekommen Besucher*innen eine Arbeit von uns, die vier Euro kostet, und für dieses Geld erhält man auch vier Euro zurück, nur eben als Gemälde, das die Münzen zeigt.
Michaela Roßberg: Jedem Objekt des Automaten liegt ein Zettel mit Informationen zu den Künstler*innen und der Objektidee bei. Bei euren beiden Werken ist zu lesen, dass eurer Meinung nach kleine Dinge oft größere soziale und historische Tendenzen widerspiegeln. Ich finde das sehr spannend, könnt ihr das näher erklären?
Natalia: Gerade in Berlin kann man diese Tendenzen zum Beispiel an Verkehrsmitteln wie der Tram sehen. Seit den siebziger Jahren gab es im Westen keine Tram mehr, sie galt als zu laut und störend. Im Osten dagegen war das Netz gut ausgebaut. Nach der Wende hat man erkannt, dass mit der Tram ohne Stau durch die Stadt zu kommen ein enorm großer Gewinn an Lebensqualität ist und es auch umweltschonender ist. Mittlerweile wird das Tramnetz stark ausgebaut.
Maria: Oder ganz simpel: Der Coffee to go. Nicht auf Deutsch „zum Mitnehmen“, sondern „to go“. Wie haben sich Menschen und die Gesellschaft entwickelt, dass sie plötzlich begeistert ihren Kaffee im Gehen trinken? Warum ist vorher noch nie jemand auf die Idee gekommen, mit seinem Kaffee in der Hand auf die Straße zu gehen? Vorher hat man in Ruhe irgendwo gesessen.
Wir versuchen auch bemerkenswerte Kleinigkeiten herauszuarbeiten, die unserer Meinung nach eine solche Tendenz abbilden. Ähnlich wie Archäolog*innen oder Anthropolog*innen versuchen wir, solche Objekte sichtbar zu machen. Stell dir vor, wie es ist, wenn man in hunderten von Jahren einen Coffee to go-Becher findet. Wahrscheinlich würden Forscher versuchen, anhand dessen Rückschlüsse auf die Gesellschaft in 2015 zu ziehen.
Michaela Roßberg: Woran arbeitet ihr momentan? Ist das da ein Ausschnitt vom Flohmarkt am Mauerpark? Zumindest kann ich als Fußballfan das Jahnstadion des BFC erkennen.
Natalia: Ja, wir haben auf dem Flohmarkt genau die Szene gesehen, wie du sie hier an der Wand siehst, haben sie fotografiert und dann mit Öl auf viele kleine Metallplatten gemalt. Die alten Möbel, die dort verkauft werden, und deren Spiegelungen in den Pfützen auf dem Gelände fanden wir faszinierend.
Maria: Die Arbeit ist ein Teil des Projekts Berlin & Berlin. Wir haben diese aus Bildern und Objekten bestehende Installation im April auf der Deutschen Woche in St. Petersburg gezeigt. Wir finden Flohmärkte so interessant, weil sie ein Abbild der momentanen Gesellschaft sind und vieles zusammenbringen, was sonst nie zusammengekommen wäre. Wie eine Barbie zusammen mit einer Matrjoschka. Beide sind sinnbildlich für verschiedene Welten, liegen nun aber zum Verkauf zusammen in der Kiste.
Michaela Roßberg: Die meisten eurer Arbeiten haben mit Berlin zu tun. Was bedeutet die Stadt für euch?
Maria: Wir versuchen jeden Ort, an dem wir gelebt haben, visuell zu erforschen. Berlin ist dabei aber etwas Besonderes, ich finde die Stadt hat unglaublich viele verschiedene Ebenen. Die sind nicht alle fröhlich und lustig, aber je tiefer man geht, desto mehr Geschichten öffnet man.
Natalia: Wir sind keine Politikerinnen oder Historikerinnen, wir betrachten diese Ebenen anders, eher visuell. Als wir hergezogen sind, war es für uns auch klar, dass wir im Osten der Stadt wohnen wollen.
Maria: Nach der Wende war der Osten der Stadt für Künstler*innen und junge Leute spannender, viel günstiger und bot mehr Möglichkeiten. Es entstanden dort viele Kunsthäuser, und neue Galerien konnten sich erst noch etablieren. Diese Energie fühlen wir immer noch. Seit Neuestem entdecken wir aber auch Westberlin. Man kann dort spannende Geschichtsebenen und tolle Kunstorte finden. Also, Stoff für neue Projekte werden wir in Berlin immer haben.
Michaela Roßberg, Wechselausstellungen