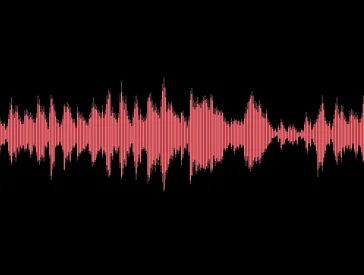Let’s Talk About Sex
Online-Feature zur Ausstellung Sex. Jüdische Positionen
Filme, Serien oder TV-Shows wie Unorthodox und Jewish Matchmaking erreichten in den vergangenen Jahren ein Millionenpublikum und lenkten die Aufmerksamkeit auf das Thema Judentum und Sexualität. Diese medialen Darstellungen prägen unsere Vorstellungen von jüdischer Sexualität, oft werden dabei statt aufzuklären aber vereinfachende Stereotype bedient.
Auch in der jüdischen Welt verändern sich Art und Umfang der öffentlichen Verhandlung sexueller Fragen. Die Ausstellung Sex. Jüdische Positionen bietet diesen neuen Stimmen zur Bedeutung von Sexualität im Judentum Raum – in der Ausstellung und online.

Alle Angebote zur Ausstellung Sex. Jüdische Positionen
Über die Ausstellung
Sex. Jüdische Positionen – 17. Mai bis 6. Okt 2024
Publikationen
- Sex. Jüdische Positionen – Katalog zur Ausstellung, deutsche Ausgabe, 2024
- Sex: Jewish Positions – Katalog zur Ausstellung, englische Ausgabe, 2024
Digitale Angebote
- Letʼs Talk About Sex – Online-Feature zur Ausstellung
- Was sagen die Künstler*innen? – Interviewreihe zur Ausstellung auf YouTube
- Soundtrack zur Ausstellung – auf Spotify
- Das Lied der Lieder. Von buchstäblicher und allegorischer Liebe – Essay von Ilana Pardes
- „Sex ist eine Kraft“ – Interview mit Talli Rosenbaum
- Androgyne Figuren in I.B. Singers literarischem Schtetl – Essay von Helena Lutz
- Jewish Places – ausstellungsbezogene, jüdische Orte auf der interaktiven Karte
Was sagen die Künstler*innen?
In der Ausstellung spielen künstlerische Positionen zur Bedeutung von Sexualität im Judentum eine wichtige Rolle. In unserer Interviewreihe kommen die Künstler*innen selbst zu Wort. Sie wird während der Laufzeit kontinuierlich um weitere Interviews ergänzt.
-
Über die Verbindung von Sexualität und Spiritualität: Interview mit Künstler Benyamin Reich
-
Über Gender und Judentum: Interview mit Künstler*in Gil Yefman
-
Über jüdisch-feministische Kunst: Interview mit Künstlerin Gabriella Boros
-
Über den Weg vom Text zum Bild: Interview mit Künsterlin Noa Snir
-
Über Kunst zwischen persönlicher Erfahrung und universellem Anspruch: Interview mit Künstlerin Susan Kaplow
-
Über radikale Selbsterfahrung und künstlerischen Ausdruck: Interview mit Künstlerin Roey Victoria Heifetz
-
Über kunstsinnigen Humor und humorvolle Kunst: Interview mit Künstler Ken Goldman
-
Über ihren Weg als orthodoxe Künstlerin: Interview mit Künstlerin Na'ama Snitkoff-Lotan
-
Über transkulturelle Identität und Kunst: Interview mit Künstlerin Siona Benjamin
Geschlechter im Judentum
Der israelische Künstler Gil Yefman ist in der Ausstellung mit seinem Kunstwerk Tumtum vertreten und geht der Frage nach, welche Geschlechtsidentitäten es im Judentum gibt:
„Talmud und Mischna unterscheiden sechs beziehungsweise sieben Geschlechtskategorien: männlich, saris (in zwei Varianten), tumtum, androginos, aijlonit und weiblich.“
Tumtum bezeichne eine Person, deren Geschlechtsorgane versteckt oder verdeckt seien, so Yefman, während bei einem Androgynos die Geschlechtsorgane weder eindeutig männlich noch eindeutig weiblich seien.
„Beide gelten als eigenständige Geschlechter, die sich zudem am eindeutigsten vom Männlichen und Weiblichen abgrenzen. Bis heute herrscht unter Gelehrten große Uneinigkeit darüber, wie man mit jenen umgehen sollte, die tumtum oder androginos sind.“
Tumtum von Gil Yefman im Glashof des Jüdischen Museums Berlin; Courtesy of the artist; Foto: Jens Ziehe; Produktion ermöglicht durch DIE FREUNDE DES JMB, mit freundlicher Unterstützung von Asylum Arts at The Neighborhood und Artis – www.artis.art
Welche Bedeutung hat LGBTIQ* im Judentum?
Die Abkürzung scheint handlich, um verschiedene Formen des Begehrens, Genderkonzepte und Lebensentwürfe unter einen Hut zu bekommen. In ihrem Beitrag dreht Debora Antmann, Mitarbeiterin des Jüdischen Museums Berlin, den Spieß um und nimmt jeden Buchstaben aus jüdischer Perspektive in den Blick.
Was bedeutet LGBTIQ*?
LGBTIQ* (Abk. für Lesben, Schwule (Gay), Bi, Trans*, Inter* und Queer), fasst verschiedene Begehrensformen, Genderkonzepte und Lebensentwürfe zusammen, das Sternchen symbolisiert die Unvollständigkeit der Aufzählung
Geschlecht und Sexualität
Nach jüdischem Rechtsverständnis spielt das Geschlecht für die Sexualität eine maßgebliche Rolle; die männliche und die weibliche Sexualität gelten als angeboren und deutlich voneinander unterschieden. Generell muss das sexuelle Begehren kontrolliert werden, doch werden an Männer und Frauen diesbezüglich je sehr spezifische Pflichten und Erwartungen gestellt.
Die rabbinischen Schriften, die sich immer an eine männliche Leserschaft wenden, behandeln die weibliche Sexualität nur im Kontext der Pflichten des Ehemanns gegenüber seiner Frau. Frauen wiederum werden auf das biologische Faktum ihres Menstruationszyklus reduziert. Im Verhältnis der Geschlechter kommt Frauen vor allem die Verantwortung zu, Männer nicht in Versuchung zu führen.
Der weibliche Körper
Heute führen Künstlerinnen wie Gabriella Boros, Nechama Golan und Hagit Molgan den Diskurs um die Sexualität und das Begehren der Frau fort, indem sie mit ihrem weiblichen Blick die vielen, von Männern entwickelten Rituale und Texte untersuchen, die den Frauenkörper über Jahrhunderte definiert und kontrolliert haben.
Als Quelle für ihre künstlerischen Auseinandersetzungen dienen die halachischen Schriften, z.B. der Talmud. Hier werden systematisch Umschreibungen für das weibliche Geschlechtsorgan, die Vulva, verwendet. Die männliche Ambivalenz diesem wichtigen und doch unheimlichen Ort gegenüber, spiegeln die einzelnen Begriffe wider: Die Vulva wird als Ort, Atem oder Grab bezeichnet. Diese Bildergalerie zeigt Werke jüdischer Künstlerinnen, in denen sie die Umschreibung des weiblichen Körpers im Talmud thematisieren.
Erotik und das Göttliche
„Mit Küssen seines Mundes küsse er mich. Süßer als Wein ist deine Liebe.“
Mit diesen Worten beginnt das Schir ha-schirim, das Lied der Lieder. Sie setzen den Ton für das, was folgt. Innerhalb der hebräischen Bibel stellt das Lied eine Ausnahme dar, denn die Sammlung erotischer Liebesgedichte enthält keine religiösen oder gesetzlichen Anweisungen. Gott kommt darin überhaupt nicht vor.
Mit seiner offenkundig erotischen Sprache feiert das Lied der Lieder die körperliche Lust – und doch gehört es zum biblischen Kanon und wird in den Synagogen jedes Jahr während Pessach vorgetragen.
Was ist
Schir ha-schirim?
Hebräisch für Lied der Lieder; wird auch als Hohelied Salomo bezeichnet; Sammlung erotischer Liebeslyrik in der Hebräischen Bibel, die jährlich zu Pessach in der Synagoge vorgetragen wird
Wie klingt das Lied der Lieder?
Schir ha-schirim wurde unzählige Male vertont – und auch sonst gibt es viel Musik von jüdischen Künstler*innen, auf Jiddisch, Hebräisch oder in anderen Sprachen der Welt, die sich mal mehr, mal weniger explizit um Sex drehen. Eine Auswahl finden Sie auf unserer Playlist zur Ausstellung.
Let’s Keep Talking About It
Welche Bücher, Filme und Serien drehen sich um Sex und Judentum? Wir haben eine erste Auswahl zusammengestellt.
Buchtipps
Deutschsprachige Titel
- Grjasnowa, Olga, Der Russe ist einer, der Birken liebt, Berlin 2012.
- Jong, Erica, Angst vorm Fliegen, Berlin 2024.
- Menasse, Robert, Don Juan de la Mancha oder Die Erziehung der Lust, Frankfurt 2007.
- Pressler, Mirjam, Für Isabel war es Liebe, Weinheim, Basel 2002.
- Roth, Philip, Portnoys Beschwerden, a. d. Eng. v. Werner Schmitz, Reinbek 2011.
- Salzmann, Sasha Marianna, Außer sich, Berlin 2017.
- Shalev, Zeruya, Liebesleben, a. d. Hebr. v. Mirjam Pressler, Berlin 2000.
- Shalev, Zeruya, Mann und Frau, a. d. Hebr. v. Mirjam Pressler, Berlin 2001.
- Shalev, Zeruya, Nicht ich, a. d. Hebr. v. Anne Birkenhauer, Berlin 2024.
- Vowinckel, Dana, Gewässer im Ziplock, Berlin 2023.
Englischsprachige Titel
- Aciman, André, Call Me By Your Name, New York 2007.
- Alderman, Naomi, Disobedience, New York 2006.
- Lamb, Sacha, When the Angels Left the Old Country, Hoboken 2022.
- Levithan, David, Wide Awake, Toronto 2006.
- Masad, Ilana, All My Mother’s Lovers, New York 2020.
- Rosen, Roee, Sweet Sweat, Antwerpen 2009.
- Singer, I.B., Enemies, A Love Story, London 2012.
- Wallach, Yona., Wild Light: Selected Poems, New York 1997.
Hebräischsprachige Titel
- Ben-Menachem, Rina, הדווקאים, Tel Aviv 2018 (1960).
Film- und Serientipps
Komödie
- Shiva Baby, Regie: Emma Seligmann, USA/CA 2020, 77 Min
- Kiss Me Kosher (Kiss Me Before It Blows Up), Regie: Shirel Peleg, DE/IL 2020, 106 Min
- Amy’s O, Regie: Julie Davis, USA 2001, 87 Min
- Kissing Jessica Stein, Regie: Charles Herman-Wurmfeld, USA 2001, 97 Min
- American Pie, Regie: Paul Weitz, USA 1999, 95 Min
- Torch Song Trilogy (Das Kuckucksei), Regie: Paul Bogart, USA 1988, 119 Min
- Eskimo Limon (Eis am Stiel), Regie: Boaz Davidson, Israel 1978, 92 Min
- Everything You Always Wanted to Know About Sex* (*But Were Afraid to Ask) (Was Sie schon immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten), Regie: Woody Allen, USA 1972, 85 Min
- Funny Girl, Regie: William Wyler, USA 1968, 149 Min
- The Graduate (Die Reifeprüfung), Regie: Mike Nichols, USA 1967, 106 Min
Drama
- Make Me A King, Regie: Sofia Olins, UK 2021, 16 Min
- Tahara, Regie: Olivia Peace, USA 2020, 77 Min
- Fig Tree, Regie: Alamork Davidian, ET/FR/DE/IL 2018, 93 Min
- Disobedience (Ungehorsam), Regie: Sebastián Lelio, USA/GB 2017, 114 Min
- Einayim Pekukhoth (Du sollst nicht lieben), Regie: Haim Tabakman, IL/DE/FR 2009, 91 Min
- The Bubble, Regie: Eytan Fox, IL 2006, 117 Min
- Yossi & Jagger, Regie: Eytan Fox, IL 2002, 65 Min
- Aimée & Jaguar, Regie: Max Färberböck, DE 1999, 121 Min
- Kadosh, Regie: Amos Gitai, IL/FR 1999, 116 Min
- Eyes Wide Shut, Regie: Stanley Kubrick, GB/USA 1999, 159 Min
- The Governess, Regie: Sandra Goldbacher, GB 1998, 114 Min
- Antonias Welt, Regie: Marleen Gorris, NL/BE/GB 1995, 96 Min
- Yentl, Regie: Barbra Streisand, USA 1983, 134 Min
- Fiddler on the Roof, Regie: Norman Jewison, USA 1971, 181 Min
- Sunday Bloody Sunday, Regie: John Schlesinger, GB 1971, 110 Min
- The Boys in the Band, (Die Harten und die Zarten), Regie: William Friedkin, USA 1970, 120 Min
- Salomé, Regie: J. Gordon Edwards, USA 1918, 80 Min
- Cleopatra, Regie: J. Gordon Edwards, USA 1917, 125 Min
Dokumentarfilm
- Mini DV, Regie: Shauly Melamed, USA 2022, 77 Min
- Jude, Regie: Helen Benigson, UK 2020, 25 Min
- Who’s Gonna Love Me Now?, Regie: Tomer Heymann/Barak Heymann, IL/GB 2016, 84 Min
- Trembling Before G-d, Regie: Sandi Simcha DuBowski, USA 2001, 84 Min
- TREYF, Regie: Alisa Lebow/Cynthia Madansky, USA 1998, 55 Min
Serie
- Kulüp (Der Club), Regie: Seren Yüce/Zeynep Günay Tan, TR 2021-heute, 2 Staffeln
- The Beauty Queen of Jerusalem, Regie: Oded Davidoff, IL 2021-2023, 2 Staffeln
- Transparent, Regie: Joey Soloway, USA 2014-2019, 5 Staffeln