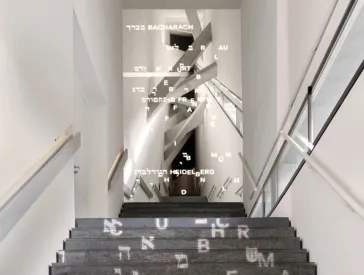Menschen brauchen Vertrauen, um leben zu können
Ein Interview mit Marina Chernivsky

Marina Chernivsky hat mit dem Verein OFEK Ehrenamtliche und Communities im Blick, die sich für Geflüchtete einsetzen; Foto: Benjamin Jenak, Veto Magazin
Marina Chernivsky ist Psychologin und Verhaltenswissenschaftlerin. Geboren in Lwiw und aufgewachsen in Israel kam sie 2001 nach Berlin; unter anderem ist sie Mitherausgeberin der Zeitschrift JALTA – Positionen zur jüdischen Gegenwart und Vorstandsmitglied von AMCHA e. V. Sie ist Initiatorin und Leiterin des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment sowie Gründerin und Direktorin der Beratungsstelle OFEK e. V.
Liebe Frau Chernivsky, Sie leiten das Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment in Trägerschaft der Zentralwohlfahrtsstelle, aber auch OFEK – die Beratungsstelle bei antisemitischer Gewalt und Diskriminierung. Was sind die Aufgaben der beiden Einrichtungen?
Das Kompetenzzentrum forscht zu Antisemitismus in Institutionen und entwickelt Projekte, Programme sowie andere Maßnahmen für die Sensibilisierung und Qualifizierung von Fach-und Führungskräften u.a. aus Bildung, Jugend- und Sozialarbeit und Verwaltung zum Umgang mit Antisemitismus und Diskriminierung. Das ist eine wissenschaftliche, pädagogische, aber auch politische Arbeit. Mit OFEK haben wir einen Verein gegründet, der sich der Beratung und Begleitung von Betroffenen antisemitischer Gewalt widmet. OFEK ist die erste Beratungsstelle in Deutschland, die sich auf Community-basierte Beratung und auf Antisemitismus spezialisiert. Dabei spielen die Einschätzung der Bedrohungspotenziale und die praktische Unterstützung bei der Bewältigung von materiellen und immateriellen Folgen von Gewalt und Diskriminierung eine zentrale Rolle.
Wie die allermeisten jüdischen Institutionen sind auch Sie aktuell sehr engagiert in der Unterstützung von Geflüchteten aus der Ukraine.
Ja! Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine war es uns wichtig, Ehrenamtliche und Communities im Blick zu haben, die sich für die Geflüchteten einsetzen. Viele Gemeinden, aber auch Schulen und andere jüdische Einrichtungen haben Geflüchtete aufgenommen, Hilfe organisiert, gar Vereine und Initiativen gegründet. Dabei geht dieser Krieg der jüdischen Community sehr nah. Es gibt biografische Verbindungen, bei einigen Helfenden gibt es direkte Bezüge zum Krieg durch Familien, die in der Ukraine leben und sich bis heute in Gefahr befinden. Viele, die sich engagieren, haben es noch nie in dieser Form gemacht. Mit dem Programm „Support for Supporters“ hat OFEK ähnlich wie zu der Pandemiezeit Gesprächsräume und sogenannte Safer Spaces angeboten, aber auch psychosoziale und psychologische Begleitung, unter anderem zu Grundsätzen der Krisenintervention, Folgen von Krieg und Traumata.
Was brauchen die Geflüchteten, wenn sie hier ankommen?
Menschen, die extreme Erfahrungen von Gewalt durchleben, befinden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Ausnahmezustand. Im Krieg wird das so wichtige Gefühl des Urvertrauens, der Sicherheit und Unversehrtheit erschüttert und der gewohnte Alltag auf den Kopf gestellt. Menschen brauchen Vertrauen, um (weiter-)leben zu können. Unterstützung, die von außen kommt, fungiert wie ein Schutzschild und eine stabilisierende Erfahrung. Neben der praktischen Unterstützung braucht es psychologische Beratung, die niedrigschwellig, traumasensibel und mehrsprachig ist. Grundsätzlich hilft auch die parteiliche Anerkennung und die ganz praktische Hilfe bei der Ankunft das Vertrauen wiederherzustellen, Orientierung wiederzufinden und die Brücke zur Normalität zu bauen, um den Bruch zwischen davor und danach irgendwann wieder zusammenzukleben. Kriege zielen nicht nur auf Einzelne, sondern auf ganze Kollektive. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist ein gezielter Versuch, kollektive Gewalt anzuwenden und die Integrität einer Nation auszulöschen. Daher sind Kriegserfahrungen niemals nur individuell, da sie massive individuelle wie auch soziale Ver- und Zerstörung auslösen. Solche Erfahrungen haben neben dem individuellen Trauma das Potenzial, sich zu einer extrem traumatischen Kollektiverfahrung zu verdichten. Dass Kriege bei den Betroffenen schwere Traumatisierungen hervorrufen können, die über den ersten Schock und adaptive Anpassung weit hinaus reichen, ist inzwischen allgemein bekannt. Dennoch gibt es wenig professionelle Unterstützung für die Betroffenen und Helfer*innen, die dringend als mehrsprachige und niedrigschwellige Ressource benötigt wird.
Warum ist es wichtig auch Supporter zu unterstützen? Was leistet OFEK dabei genau?
OFEK ist eine Beratungsstelle bei antisemitischer Gewalt, nicht bei der Bewältigung von Kriegsfolgen. Aber OFEK arbeitet auch nah an Communities und diese haben flächendeckend Hilfe geleistet. Deshalb war es uns wichtig die Gemeinden so weit wie möglich darin zu stärken. Es gibt kollegiale Beratung, aber auch Workshops und Supervision für ehrenamtliche wie auch hauptamtliche Helfer*innen. Manche Gespräche waren sehr aufwühlend; es war spürbar, dass die Nähe zu diesem Krieg die eigene Betroffenheit in den Fokus rückt. OFEK hat ein eigenes psychologisches Team und einige russischsprachige Psycholog*innen. Diese waren viel im Einsatz, aber auch andere Psycholog*innen und Berater*innen haben die Anleitung von Gesprächsräumen übernommen. Da es nicht ausreichend Angebote einer ukrainisch- oder russischsprachigen psychologischen Beratung gab, mussten wir bei Anfragen überbrücken, wobei das nicht zum primären Angebot von OFEK gehört. Grundsätzlich waren diese Angebote direkt nach dem Kriegsbeginn relevanter als heute; inzwischen gibt es einen gewissen Habituationseffekt und auch viel Erfahrung. Ferner verdichtet sich auch das Potenzial u.a. antisemitisch motivierter Gewalt, zum Beispiel an Schulen. Verschwörungsmythen, gruppenbezogene Konflikte und gar Gewalthandlungen häufen sich und bedingen den Bedarf an spezialisierter Beratung.
Sie sind bei einem Podiumsgespräch im JMB darauf eingegangen, wie problematisch der Begriff Kriegsopfer ist. Warum ist das so?
Der Begriff ist nicht grundsätzlich falsch, der Krieg muss ja beim Namen genannt werden. Es ist aber auch wichtig, diesen Begriff nicht als Statusbeschreibung zu verwenden. Der Status eines Kriegsopfers wird schnell zu einer Eigenschaft, die dem Subjekt seine Individualität und Eigenständigkeit nimmt. Selbst nach extremer Traumatisierung sind Menschen nicht zwingend krank, da Trauma zunächst eine normale Reaktion darstellt auf ein abnormales Ereignis, auf eine extreme Belastung. Kriegsopfer zu sein, wird sicher für viele Menschen Teil der eigenen Biografie. Aber sie sollten selbst entscheiden, wie sie sich selbst sehen und beschreiben. Wir könnten die Folgen des Krieges im Blick behalten, ohne die Betroffenen ausschließlich aus diesem Blickwinkel oder nur in der Opferrahmung wahrzunehmen.
Was bedeutet der Krieg für die ukrainische Gesellschaft?
Der Krieg ritzt sich nicht nur im individuellen Gedächtnis der Menschen ein, sondern traumatisiert eine ganze Gesellschaft. Die Zeit nach dem Krieg wird kommen und die ukrainische Gesellschaft noch lange beschäftigen. Ich bin zuversichtlich, dass die weitgehende Demokratisierung, die veränderte politische Situation und die wachsende, starke Zivilgesellschaft diesen Prozess gut meistern werden. Auch jetzt sehe ich eine enorme Resilienz und einen Zusammenhalt, der den Einzelnen das Gefühl der kollektiven Selbstwirksamkeit (zurück) gibt. Die gesellschaftliche Haut, die durch den Krieg zerschmettert und durchbohrt wird, wird sich, wenn auch nicht ohne Folgen, wieder zusammenziehen. Die Narben werden bleiben.
Was in der Ukraine derzeit geschieht, beeinflusst ja auch unseren Blick auf Europa.
Ja, total! Alles, was jetzt passiert, ist ja mit deutscher und europäischer Geschichte eng verbunden. Eigentlich müsste ja jeder Krieg, egal wo, Erschütterung hervorrufen. Aber je näher es kulturell oder geographisch ist, desto spürbarer ist dieses Erdbeben. Das hat aber auch mit Fragen von Privilegien zu tun: Was leisten wir uns nicht zu sehen und nicht zu wissen? Interessant ist in dem Kontext, dass die Geschichte und Gegenwart eines osteuropäischen Landes wie die Ukraine natürlich auch mit der Geschichte und dem Erbe des Nationalsozialismus und der Schoa eng verwoben sind. Da sind die Traumata des Zweiten Weltkriegs noch nicht vorüber und nicht ganz geschlossen.
Können sich diese Wunden überhaupt schließen?
Kriege, Genozide hinterlassen Folgen, die nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich relevant sind. Die Aufarbeitung von generationsübergreifenden (Gefühls-)Erbschaften ist dann eine Aufgabe für die Nachkommen. Dabei sind die Wirkungen für die Betroffenen oftmals anders als für jene, die auf der anderen Seite standen. Die Unterschiede sind nicht unwichtig, denn damit sind politische und psychologische Fragen verbunden. Die Anerkennung des Unrechts ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen produktiven Umgang mit Vergangenheit. Dabei sind die Fragen der familienbiografischen und sozialen Positionierung ganz zentral. Idealtypisch gilt: Je offener sich eine Gesellschaft erinnert, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Wunde zu einer Narbe wird, die langsam verheilt.
Was würden Sie sich politisch oder gesellschaftspolitisch wünschen?
Ich kann keine Ansprüche stellen. Ich bin in Lviv geboren und in Israel aufgewachsen. Ich lebe seit über 20 Jahren in Deutschland. Mein Blick auf die Ukraine ist einer von außen. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Menschen dort es schaffen, den Neubeginn zu versuchen und zu meistern. Die Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Gesellschaft ist gegeben; auch die Bereitschaft sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Ich engagiere mich in einem wichtigen Projekt, das sich mit der Erinnerung an die Schoa und der Gedenkstättenarbeit beschäftigt. Ich bewundere all diejenigen, die sich trotz der anhaltenden Belastung dem Thema stellen und die Erinnerung an die Verfolgung und Vernichtung von Jüdinnen und Juden in der Ukraine wachhalten.
Zitierempfehlung:
Jüdisches Museum Berlin (2022), Menschen brauchen Vertrauen, um leben zu können. Ein Interview mit Marina Chernivsky.
URL: www.jmberlin.de/node/9519