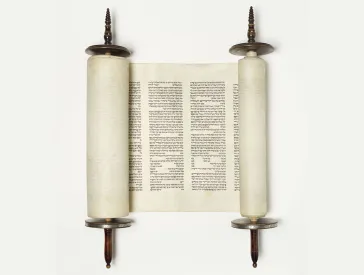Die Künstlerin und die Naturwissenschaftlerin
Über die Schwestern Gertrud und Margarete Zuelzer

Die Schwestern Gertrud (1873–1968) und Margarete Zuelzer (1877–1943) in Kostümen, ca. 1900; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2014/192/5, Schenkung von Max Bloch
Im Rahmen unseres Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur (FSJ K) haben wir, Annika Späth und Lena Katz, uns für ein eigenverantwortliches Projekt entschieden, bei dem wir Bestände aus dem Archiv des Jüdischen Museum Berlin (JMB) und dahinterliegende Biografien auf der Website des JMB sichtbar machen. Bei der Recherche stießen wir auf die Geschwister Gertrud und Margarete Zuelzer. Beeindruckt hat uns an den Biografien der Zusammenhalt der Schwestern. Außerdem verfolgten die beiden unverheirateten Frauen ihre jeweiligen Karrieren und stellten, ob bewusst oder unbewusst, die damaligen Geschlechterrollen in Frage.
Gemeinsame Kindheit
Gertrud Zuelzer kommt am 26. November 1873 zur Welt. Drei Jahre später folgt am 7. Februar 1877 ihre Schwester Margarete. Ihre Mutter Henriette Zuelzer (geb. Friedländer) und ihr Vater, der Tuchfabrikant Julius Zuelzer, ziehen die beiden Mädchen und ihre ältere Schwester Anna im niederschlesischen Haynau auf. Im Jahr 1880 entscheiden sich die Eltern mit ihrer Familie nach Berlin umzuziehen, um ihren Töchtern bessere Bildungschancen zu ermöglichen.
„Wie viele Juden zog es Julius Zuelzer aus Schlesien in das aufstrebende Berlin, und die Sicherung einer guten Ausbildung für alle Kinder – nicht nur für die Söhne – gehörte zu den Selbstverständlichkeiten in jüdischen Familien, sofern sie es sich finanziell leisten konnten.ˮ (Rede von Annette Vogt anlässlich der Stolpersteinverlegung am 2. September 2012)
Gertrud und Margarete entwickeln bereits früh eine enge Beziehung, die auch über die Zeit im Elternhaus hinaus anhält.
Ausbildung zur Landschafts- und Porträtmalerin
Gertrud beginnt Ende des 19. Jahrhunderts eine Ausbildung zur Kunstmalerin in Berlin. Zeitweise studiert sie in Frankreich und lernt bei verschiedenen Künstlern wie Franz Lippisch, Gustave Courtois, Charles Cottet und Lucien Simon, in dessen Pariser Atelier sie vorübergehend malt. Besonders inspirierend findet sie die Kunst von Paul Cézanne.
Die Schwestern Anna (1872–1948), Gertrud (1873–1968) und Margarete Zuelzer (1877–1943), ca. 1880; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2014/192/3, Schenkung von Max Bloch. Weitere Informationen zu diesem Dokument finden Sie in unserer Online-Sammlung
-
Gertrud Zuelzer, Meine Mutter, ca. 1900-1931; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2014/199/13, Schenkung von Max Bloch
-
Gertrud Zuelzer (1873–1968) bei der Arbeit im Atelier von Lucien Simon (1861–1945), ca. 1905; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2014/192/7, Schenkung von Max Bloch. Weitere Informationen zu diesem Dokument finden Sie in unseren Online-Sammlungen
-
Gertrud Zuelzer, Schwarzwald, Entstehungsjahr unbekannt; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2014/199/5, Schenkung von Max Bloch
Frauenstudium und Promotion
Ihre kleine Schwester Margarete studiert ab dem Wintersemester 1898 Naturwissenschaften an der Universität zu Berlin und gehört damit zu der ersten Generation weiblicher Studierender. Da das sogenannte Frauenstudium zu dieser Zeit in Berlin noch verboten ist, kann sie nur als Gasthörerin an den Vorlesungen teilnehmen. Um aber als „echte” Studentin angenommen zu werden und damit ihren Abschluss erwerben zu können, wechselt Margarete im Sommer 1902 an die Universität Heidelberg. Dort kann sie 1904 als erst sechste Frau an der naturwissenschaftlichen Fakultät promovieren.
-
Margarete Zuelzer (oben links) (1877–1943) als Studentin im Hörsaal, ca. 1902-1904; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2014/190/2, Schenkung von Max Bloch. Weitere Informationen zu diesem Dokument finden Sie in unserer Online-Sammlung
-
Margarete Zuelzer (1877–1943) als Studentin im Labor, 1902; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2014/192/117, Schenkung von Max Bloch. Weitere Informationen zu diesem Dokument finden Sie in unserer Online-Sammlung
-
Begleitbrief von der Universität Heidelberg betreffend der Promotionsurkunde für Margarete Zuelzer (1877–1943), 07.10.1904; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2014/186/317, Schenkung von Max Bloch. Weitere Informationen zu diesem Dokument finden Sie in unserer Online-Sammlung
Gemeinsames Leben in Berlin
Als die beiden Schwestern nach ihren Ausbildungen, Anfang des 20. Jahrhunderts, nach Berlin zurückkehren, leben sie gemeinsam in einer Wohnung in Charlottenburg. Ihr wohlhabender Onkel Friedrich von Friedländer-Fuld unterstützt sie finanziell. Das ermöglicht den beiden ihre Leidenschaften als Künstlerin und Wissenschaftlerin auszuüben.
Nach vier Jahren Unterricht bei Arthur Kampf macht sich Gertrud in eigenem Atelier mit der Kunstmalerei selbstständig. Auf verschiedenen Ausstellungen in Berlin etabliert sie sich als Porträt- und Landschaftsmalerin, darunter die Große Berliner Kunstausstellung 1918.
Bereits 1916, während des Ersten Weltkriegs, entscheidet sich Margarete zum Christentum zu konvertieren und lässt sich in der Jerusalems-Kirche in Berlin taufen.
„Es kann nur gemutmaßt werden, ob diese Konversion von Erwägungen des beruflichen Fortkommens diktiert gewesen sei, ja dass sie vielleicht die Voraussetzung ihrer Anstellung gewesen sein könnte. Dem kann nur erwidert werden, dass ihre Schwester, die als freischaffende Künstlerin keinen engeren beruflichen Zwängen unterlag, diesen Schritt ebenfalls, am 23. Dezember desselben Jahres, wiederum in der Jerusalems-Kirche vollzog. Die patriotische Aufwallung des Kriegs mag diese Entscheidung mitgetragen haben: Margarete erhielt am 16. Juli 1918 für ihre bakteriologische Tätigkeit das Verdienstkreuz für Kriegshilfe; Gertrud leitete als freiwillige Kriegsschwester seit April 1918 ein Soldatenheim an der Westfront.“ (Rede von Max Bloch anlässlich der Stolpersteinverlegung am 2. September 2012)
Die Schwestern Gertrud (1873–1968) und Margarete Zuelzer (1877–1943) in Kostümen, ca. 1900; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2014/192/5, Schenkung von Max Bloch. Weitere Informationen zu diesem Dokument finden Sie in unserer Online-Sammlung
Verwendungsbuch von Gertrud Zuelzer (1873–1968) aus dem Ersten Weltkrieg, 29.04.1918; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2014/186/58, Schenkung von Max Bloch. Weitere Informationen zu diesem Objekt finden Sie in unserer Online-Sammlung
Von der Hilfsarbeiterin zur Regierungsrätin
Margarete kann sich nach ihrer Rückkehr nach Berlin als erfolgreiche Wissenschaftlerin beweisen. Den Einstieg in ihre Karriere macht sie dort zunächst als Hilfsarbeiterin an der Königlichen Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung. Mit dem Beginn ihrer Arbeit am Kaiserlichen Gesundheitsamt 1916 kann sie sich dann auf die Erforschung von Protozoen, Einzellern, spezialisieren. Drei Jahre später schafft sie den Aufstieg zur Regierungsrätin und leitet das Protozoenlaboratorium im Ortsteil Dahlem. Ein Amt, das zu dieser Zeit keine andere Frau in Berlin innehat.
Ihre Forschung zur Weilschen Krankheit, einer Infektionskrankheit, die durch Bakterien ausgelöst wird, wird auch über die Grenzen Deutschlands wahrgenommen. Im Auftrag der niederländischen Regierung unternimmt Margarete 1926 eine Forschungsreise zu Tropenkrankheiten in die damalige Kolonie Niederländisch-Indien. Ihre Eindrücke aus Sumatra, Java, Malaysia und Bali hält sie in umfangreichen Reiseberichten fest:
„Schon in der ersten halben Stunde meiner Fahrt durch das Land lernte ich, mit allen hergebrachten Vorstellungen zu brechen. Als ich mich mit konzentrierter Aufmerksamkeit allen Eindrücken dieser Fahrt hingab, war nämlich meine erste Reflektion: „Hier gibt es ja Spatzen! Viele Spatzen!” Ich hatte damit gerechnet, Affen in Mengen – landläufig wie bei uns Spatzen – zu begegnen. Das war aber nicht so. Es hat drei Wochen gedauert, bis ich den ersten Affen in der Wildnis zu sehen bekam.“ (Margaretes Reisetagebuch S.1 ca. 1926; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2014/186/392, Schenkung von Max Bloch )
Bestallungsurkunde des Reichsgesundheitsamts für Margarete Zuelzer (1877–1943), 18.09.1919; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2014/186/326, Schenkung von Max Bloch. Weitere Informationen zu diesem Dokument finden Sie in unserer Online-Sammlung
Margarete Zuelzer (1877–1943) bei der Probenentnahme auf einer Forschungsreise, ca. 1926-1928; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2018/266/42, Schenkung von Max Bloch. Weitere Informationen zu diesem Dokument finden Sie in unserer Online-Sammlung
Nach ihrem etwa zweijährigen Auslandsaufenthalt kehrt Margarete in ihre Heimat Berlin zurück. Hier setzt sie ihre Karriere im Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische Chemie fort und forscht weiterhin in ihrem Fachgebiet.
Nationalsozialistische Machtübernahme und Berufsverbot
Im April 1933, zwei Monate nach der nationalsozialistischen Machtübernahme, wird Margarete als „nicht-arische” Person aufgrund der rassistischen Gesetzgebung für den öffentlichen Dienst in den sofortigen „Ruhestand” versetzt und kann von einem Tag auf den anderen ihren Beruf nicht mehr ausüben. Erschüttert von diesen Nachrichten verfasst Margarete ein Beschwerdeschreiben und schreibt:
„Ich habe keiner Partei angehört, mich stets aller Parteipolitik ferngehalten und ausschließlich meiner wissenschaftlichen Tätigkeit gelebt.“
Doch auch dieser Brief kann sie nicht vor einer Entlassung bewahren.
Brief mit Stellungnahme Margarete Zuelzers (1877–1943) betreffend des Berufsbeamtengesetzes, ca. 1933; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2014/186/344, Schenkung von Max Bloch. Weitere Informationen zu diesem Objekt finden Sie in unserer Online-Sammlung
„Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums”
Das am 7. April 1933 erlassene Gesetz dient der Entlassung von Gegner*innen des NS-Regimes aus dem öffentlichen Dienst und der Gleichschaltung von diesem. Außerdem bestimmt der erstmals formulierte „Arierparagraph“ (Paragraph 3) die sofortige Versetzung in den „Ruhestand“ von Personen, die gemäß der rassistischen Ideologie der Nazis als „nichtarisch” gesehen werden.
Durch die Gründung der Reichskunstkammer im September 1933, wird auch Gertrud gezwungen ihren Beruf aufzugeben. Ohne eigenes Einkommen muss sie deshalb von dem Erbe ihres Onkels leben.
Reichskunstkammer
Die Reichskunstkammer wird am 22. September 1933 durch das Propagandaministerium gegründet und gliedert alle bereits existierenden Berufsverbände aus der Kultur ein. Sie dient der Gleichschaltung, Überwachung und Kontrolle der Kunst. Nicht aufgenommen oder ausgeschlossen werden Künstler*innen, die gemäß der nationalsozialistischen Ideologie als „nichtarisch“ angesehen werden oder nicht regimekonform sind. Für sie bedeutet dies praktisch ein Berufs- und Veröffentlichungsverbot.
Trennung der Schwestern
Die Schwestern leben noch bis 1939 in Berlin zusammen. Margarete kann nicht akzeptieren, dass sie ihrer Arbeit nicht nachgehen kann und sucht nach Projekten außerhalb von Deutschland. Als im Ausland weiterhin anerkannte Expertin nimmt sie an dem internationalen Kongress für Mikrobiologie 1936 in London teil. Dank der Hilfe ihres früheren niederländischen Arbeitskollegen Wilhelm Schüffner bekommt Margarete im Oktober 1939 schließlich eine Anstellung am Institut für tropische Hygiene in Amsterdam, woraufhin sie in die Niederlande emigriert.
Aus dem Exil hält Margarete über kurze Briefe den Kontakt zu ihrer Schwester. Und das auch nachdem Gertrud im Sommer 1942 untertaucht und einen Fluchtversuch in die Schweiz wagt. Festgehalten an der Grenze, wird die Künstlerin verhaftet und über mehrere Gefängnisse im November in das Ghetto Theresienstadt deportiert.
Immer wieder lässt Margarete ihrer älteren Schwester Briefe und Pakete gefüllt mit Kleidung und Kunstutensilien zukommen. Mithilfe dieser Pakete kann Gertrud andere Inhaftierte porträtieren und sich mit einer Zusatzration Lebensmittel bezahlen lassen. Mit Margaretes Unterstützung schafft sie es so die Zeit im Ghetto zu überleben.
„Eine alte Freundin aus Berlin, Frau Geheimrat Strauss, hatte mich schon Weihnachten 1942 gebeten, ihren Mann zu zeichnen. Die Zeichnung glückte und darauf bekam ich viele Aufträge, Zeichnungen zu machen. Schwester Grete und Lotte Otzen hatten mir Farbstifte geschickt, Papier beschaffte ich mir, so habe ich über 100 Porträtzeichnungen gemacht. Da die Tschechen viel Pakete bekamen, bezahlten sie mich mit Brot und ich glaube, dass ich es diesem Umstand zu verdanken habe, dass ich am Leben geblieben bin” (Gertrud Zuelzer/ Rede von Max Bloch anlässlich der Stolpersteinverlegung am 2. September 2012)
Margarete Zuelzer (1877–1943) im niederländischen Exil, ca. 1939-1940; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2014/192/112, Schenkung von Max Bloch. Weitere Informationen zu diesem Dokument finden Sie in unserer Online-Sammlung
-
Gertrud Zuelzer, Zwei Frauenporträts, Januar - Februar 1943; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2014/187/2, Schenkung von Max Bloch. Weitere Informationen zu diesem Objekt finden Sie in unserer Online-Sammlung
-
Vorderseite einer Postkarte von Margarete Zuelzer (1877–1943) an ihre Schwester Gertrud (1873–1968) im Ghetto Theresienstadt, 12.12.1942; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2014/186/379, Schenkung von Max Bloch. Weitere Informationen zu diesem Objekt finden Sie in unserer Online-Sammlung
-
Rückseite einer Postkarte von Margarete Zuelzer (1877–1943) an ihre Schwester Gertrud (1873–1968) im Ghetto Theresienstadt, 12.12.1942; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2014/186/379, Schenkung von Max Bloch. Weitere Informationen zu diesem Objekt finden Sie in unserer Online-Sammlung
Auch in den Niederlanden setzt das Nationalsozialistische Regime nach seiner Invasion im Frühjahr 1940 antijüdische Maßnahmen durch. Im Mai 1943 wird Margarete in das Durchgangslager Westerbork deportiert, hier verstirbt sie am 29. August. Die Todesursache ist nicht bekannt. Schwer getroffen von dem Tod ihrer Schwester, verarbeitet Gertrud ihre Gefühle in einem Gedicht, das sie Margarete widmet:
Viel hast Du mir gegeben
durch Herzlichkeit und Geist
schön war Zusammenleben
nun bin ich ganz verwaist!
Umsorgt hast Du mich treulich
vom allzufernen Ort.
Ich kann es noch immer nicht fassen
dass Du gestorben bist.
Verlassen, Freunde und Arbeit
Die Wissenschaft, Streben und Ruhm!
Das Schöne, das du so liebtest!
Wir liebten dein Menschentum:
Wie Dein Charakter, Dein Tun bestimmte
Wie eng mit den Deinen Du bliebst verwebt
Wie mitteilsam, hilfsbereit, heiter Dein Sinn –
so, wie Du warst, es in uns lebt.
Gertrud (1873–1968) und Margarete Zuelzer (1877–1943), ca. 1930; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2014/192/8, Schenkung von Max Bloch. Weitere Informationen zu diesem Dokument finden Sie in unserer Online-Sammlung
Gertrud kehrt 1945 zurück nach Berlin. Ihre Karriere als Künstlerin setzt sie fort und stellt ihre Kunst auf der Berliner Kunstausstellung 1950 und im Charlottenburger Rathaus 1956 aus.
Mit 95 Jahren verstirbt Gertrud 1968 in ihrer Heimat Berlin. Der Tod der Schwester prägt sie bis an ihr Lebensende.
Zitierempfehlung:
Lena Katz, Annika Späth (2022), Die Künstlerin und die Naturwissenschaftlerin. Über die Schwestern Gertrud und Margarete Zuelzer.
URL: www.jmberlin.de/node/9203