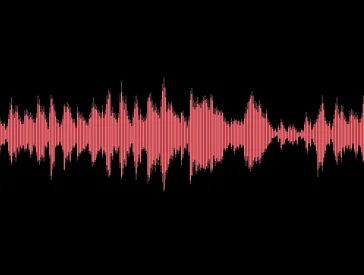Beargwöhnt und herausgehoben: Jüdinnen*Juden in der DDR
Die Geschichte der Jüdinnen*Juden in der DDR beginnt nicht erst mit der Gründung des Staates am 7. Oktober 1949. Vielmehr wurden schon seit Mai 1945 die Weichen gestellt für die spätere Teilung in Ost und West, den Kalten Krieg, die stalinistischen Säuberungen und die Bedingungen jüdischen Lebens im Osten. Gleichzeitig gab es in diesen Jahren Ansätze für einen anderen Gang der Geschichte, andere Möglichkeiten, die nicht verwirklicht wurden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Schoa
Eine äußerst heterogene Gruppe von überlebenden Jüdinnen*Juden fand sich nach dem Ende von Krieg und Verfolgung sowohl in der sowjetischen als auch den drei anderen Besatzungszonen des zerstörten, zerstückelten Täter-Landes zusammen. Sie waren aus den Vernichtungslagern befreit worden, hatten in den Armeen der Alliierten gekämpft oder kehrten aus dem Exil zurück, sie hatten im Untergrund überlebt oder waren von ihren nichtjüdischen Ehepartner*innen geschützt worden. Ein Teil von ihnen betrachtete den Aufenthalt in Deutschland zunächst nur als Zwischenstation auf dem Weg nach Palästina oder in die USA. Zahlreiche andere kamen ganz bewusst nach Deutschland zurück, weil sie hofften, dort eine neue Gesellschaft mitgestalten zu können.
Ein wichtiger Ziel- und Knotenpunkt für den Rück- und Zustrom der Überlebenden und Remigrant*innen war Berlin, das von den vier Besatzungsmächten verwaltet wurde. Die neu konstituierte Berliner Jüdische Gemeinde hatte ihren Sitz im sowjetischen Sektor in der Oranienburger Straße. Ihr erster kommissarischer Vorsitzender, Erich Nelhans, gehörte zu der damals innerhalb der Gemeinde dominierenden Gruppe, die jüdisches Leben in Deutschland nach der Schoa nicht mehr für möglich hielt und sich für die Übersiedlung nach Palästina und den Aufbau eines jüdischen Staates einsetzte.
Reisetruhe von Josef und Lizzi Zimmering, 1930er- bis 1940er-Jahre: Sie überlebten die Verfolgung durch die Nazis im Exil. Josef Zimmering (1911–1995) übernahm nach der Gründung der DDR wichtige Funktionen im Staat; Leihgabe der Familie Zimmering, Foto: Roman März
Nelhans kümmerte sich auch um die Holocaust-Überlebenden aus Osteuropa, die zu Zehntausenden vor dem polnischen Nachkriegsantisemitismus in Richtung Westen flohen. Viele von ihnen meldeten sich bei der Jüdischen Gemeinde im sowjetischen Sektor von Berlin, von wo sie in die amerikanischen und französischen Sektoren weitergeleitet wurden, in denen Lager für Displaced Persons eingerichtet worden waren. Nelhans geriet ins Visier des sowjetischen Geheimdienstes, nachdem er jüdischen Rotarmisten zur Flucht in den Westen verholfen hatte. Er wurde im März 1948 in seiner Ostberliner Wohnung verhaftet und von einem sowjetischen Militärgericht zu 25 Jahren Lagerhaft verurteilt. 1950 starb er im mordwinischen DubrawLag.
Bereits im Sommer und Herbst 1945 konstituierten sich auch in einigen anderen Städten in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) jüdische Gemeinden. Initiiert wurden sie zumeist von Jüdinnen*Juden, die durch ihre nichtjüdischen Ehepartner*innen vor der Deportation bewahrt worden waren. Zu ihnen gesellten sich in den folgenden Wochen und Monaten Überlebende aus den Lagern und Ghettos, Flüchtlinge aus Osteuropa sowie aus dem Versteck Aufgetauchte. Die Zahl der Mitglieder in diesen ersten Gemeinden in Leipzig und Zwickau, Dresden, Chemnitz, Erfurt und Magdeburg wuchs zunächst rasch an und verminderte sich spätestens seit 1949 in ähnlichem Tempo. Kleinere Gemeinden zum Beispiel in Plauen, Mühlhausen, Eisenach und Jena lösten sich zwischen 1948 und 1953 wieder auf.
Was sind Displaced Persons?
Displaced Persons, Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg außerhalb ihres Herkunftslandes gestrandet waren, darunter in westlichen Besatzungszonen ca. eine Viertelmillionen Jüdinnen*Juden
Neubeginn
Der Versuch eines Neubeginns jüdischen Lebens fand unter widersprüchlichen Bedingungen statt. Die sowjetische Militäradministration und die meisten Länderregierungen unterstützten die Wieder- bzw. Neugründung der Gemeinden und bemühten sich um die Versorgung der überlebenden Rückkehrer*innen und Zuwanderer*innen mit dem Allernötigsten (ein Dach über dem Kopf, Kleidung, gesundheitliche Betreuung und zusätzliche Lebensmittelrationen), während in der Bevölkerung ebenso wie in lokalen Behörden der Antisemitismus nach wie vor virulent war.
Um die Unterstützung ihrer Mitglieder zu bewältigen, arbeiteten die Gemeindevertreter*innen eng mit den örtlichen Ausschüssen für die Opfer des Faschismus (OdF) zusammen. In den OdF-Ausschüssen, die mehrheitlich von aus der Haft befreiten politischen Häftlingen gegründet worden waren, hatte es im Sommer 1945 zunächst Widerstände gegeben, Holocaust-Überlebende als „Opfer des Faschismus“ anzuerkennen, mit der Begründung, sie hätten zwar „Schweres erlitten, aber sie haben nicht gekämpft“
.1 Bereits wenige Monate später, im Oktober 1945, wurde diese Einstellung auf der Leipziger Tagung der OdF-Ausschüsse aus allen Teilen der SBZ korrigiert. Der Meinungsumschwung war vor allem dem Engagement von Julius Meyer und Heinz Galinski zu verdanken, die im Berliner OdF-Hauptausschuss daraufhin die Abteilung „Opfer der Nürnberger Gesetzgebung“ gründeten.
Dringend benötigte Hilfe für die Überlebenden kam auch vom „Joint Distribution Committee“ (kurz Joint genannt), einer jüdisch-amerikanischen Hilfsorganisation, deren Lebensmittelspenden und Hilfeleistungen über die jüdischen Gemeinden verteilt wurden, seit 1947 auch in der SBZ.
1947/48 wurde in allen vier Besatzungszonen die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) gegründet, die sich anfangs als überparteiliche Interessenvertreterin aller Verfolgten verstand. Unter den Mitgliedern der Vereinigung bildeten die jüdischen NS-Verfolgten eine große Gruppe, in Berlin waren sie sogar in der Mehrheit. Obwohl in der VVN die Unterscheidung zwischen „Kämpfern“ und „Opfern“ ein Streitpunkt blieb, funktionierte die Zusammenarbeit zwischen VVN und Jüdischen Gemeinden zunächst gut, nicht zuletzt, weil führende Repräsentant*innen der Jüdischen Gemeinden häufig zugleich Funktionen in der Vereinigung innehatten.
Katalog zur Ausstellung Ein anderes Land. Jüdisch in der DDR, in dem u.a. eine ausführlichere Fassung des vorliegenden Essays zu finden ist
Kalter Krieg
Bereits 1948 war die Chance auf ein gemeinsames Handeln der vier Besatzungsmächte in Deutschland bei der Überwindung des nationalsozialistischen Erbes sichtbar vorbei. Der Kalte Krieg und die Gründung von BRD und DDR setzte neue machtpolitische Prioritäten, an denen die ohnehin fragilen antifaschistischen Bündnisse zerbrachen.
Während die VVN in der Bundesrepublik 1950 als „radikale Organisation“ eingestuft und vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, besaß die Organisation in der DDR bis zu ihrer erzwungenen Auflösung 1953 ein großes politisches und moralisches Gewicht: Die Ost-VVN stellte Abgeordnete, unterhielt Kurheime, gab mehrere Zeitschriften heraus und verfügte über einen Buchverlag. Unter anderem nahm sie Einfluss auf die Ausarbeitung eines Wiedergutmachungsgesetzes. Dieses enthielt Klauseln für eine besondere Rentenregelung, bevorzugte Gesundheitsversorgung, eine bevorzugte Versorgung mit Wohn- und Gewerberaum, Hausrat und knappen Konsumgütern, jedoch keine für Rückerstattung geraubten Eigentums oder materielle Entschädigungen.
Die anfangs postulierte Überparteilichkeit der VVN bestand bald nur noch auf dem Papier. Seit 1948 erlangte die SED nach und nach die Kontrolle über die leitenden Gremien der Vereinigung und begann deren Tätigkeit dem neuen Freund-Feind-Denken des Kalten Krieges unterzuordnen.
Alice Zadek mit ihrer Tochter Ruth und ihrem Neffen David Hopp auf der Stalinallee (Karl-Marx-Allee), Berlin ca. 1956; Jüdisches Museum Berlin, Schenkung von Ruth Zadek, Foto: Gerhard Zadek. Gerhard (1919–2005) und Alice Zadek (1921–2005) kehrten 1947 aus dem britischen Exil nach Berlin zurück. In der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR waren die Zadeks von Anfang an in das politische System eingebunden. Als Westemigranten verloren sie jedoch 1953 ihre Funktionen und Ämter.
Der Slánský-Prozess und seine Folgen
Spätestens seit dem stalinistischen Schauprozess gegen Rudolf Slánský Ende 1952 in Prag, der eine eindeutig antisemitische Färbung hatte, standen die Jüdinnen*Juden in der DDR unter doppeltem Druck: Auf der einen Seite mussten sie sich gegen die fortdauernde und sogar wieder anwachsende Feindseligkeit großer Teile der Bevölkerung wehren, auf der anderen Seite waren sie dem stalinistischen Antisemitismus aus der Sowjetunion ausgesetzt.
Nachdem Julius Meyer, SED-Mitglied und Präsident des Verbandes der Jüdischen Gemeinden in der DDR, 1953 in Vernehmungen gegenüber der sowjetischen Kontrollkommission sowie der Kontrollkommission der SED aufgefordert worden war, die Listen der Empfänger*innen von Joint-Paketen auszuhändigen und den Dachverband zu einer öffentlichen Distanzierung vom Joint sowie zu einer Verurteilung des Zionismus zu bewegen, fuhr Meyer nach Leipzig, Dresden und Erfurt, um die führenden DDR-Gemeindevertreter vor den drohenden Verfolgungen zu warnen. Günter Singer, Helmut Salo Looser, Leo Löwenkopf, Fritz Grunsfeld und Leo Eisenstädt flohen noch am gleichen Tag nach Westberlin. Andere Gemeindemitglieder folgten. In einer Atmosphäre der antisemitischen Hetze in den Medien und unter dem Eindruck polizeilicher Durchsuchungen von Gemeindebüros sowie willkürlicher Maßnahmen örtlicher Behörden gegen anerkannte Verfolgungsopfer setzte sich die Fluchtwelle bis in den Herbst 1953 fort.
Von den Verdächtigungen und Verfolgungen waren auch Partei- und Staatsfunktionäre jüdischer Herkunft betroffen, die keinen Kontakt zur Gemeinde unterhielten.
Zerfall der Gemeinden
Die Ereignisse der Jahre 1948 bis 1953 und ihre Folgen prägten bis 1989 das Leben der Jüdinnen*Juden in der DDR. Die meisten Gemeinden hatten ihre Vorstände verloren, ihnen fehlten Rabbiner, Kantoren und Vorbeter. Die Zahl ihrer Mitglieder hatte sich dramatisch verringert, nicht nur aufgrund der Fluchtbewegungen. Viele SED-Mitglieder waren aus Angst vor Repressalien aus der Religionsgemeinschaft ausgetreten. In Berlin zerfiel die Gemeinde endgültig in einen Ost- und einen Westteil. Nach Stalins Tod gab es zwar keine gezielte antisemitische Verfolgung mehr, doch die geäußerten Vorwürfe und Verdächtigungen wurden offiziell niemals zurückgenommen und lebten unterschwellig fort – als Angst auf der einen und als Ressentiment auf der anderen Seite.
Mit der erzwungenen Auflösung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, an deren Stelle das Zentralkomitee der SED ein „Komitee der Antifaschistischen Widerstandskämpfer“ installierte, hatten die überlebenden Jüdinnen*Juden ebenso wie viele andere Verfolgtengruppen keine politische Stimme mehr. Die jüdischen Gemeinden konnten diese Lücke nicht füllen, sie blieben im Wesentlichen auf die Ausübung des religiösen Kultus beschränkt.
Aufgrund der geringen Zahl ihrer Mitglieder, aber vor allem wegen der gescheiterten Wiedergutmachung waren die jüdischen Gemeinden finanziell völlig abhängig von staatlichen Geldern.
Die DDR-Erinnerungspolitik
In den offiziellen Gedenkveranstaltungen spielte das Thema der Verfolgung und Ermordung der Jüdinnen*Juden bis etwa zur Mitte der 1980er-Jahre nur eine geringe Rolle; im Zentrum der staatlichen Erinnerungspolitik stand der kommunistische Widerstand. Dabei waren die nationalsozialistischen Verbrechen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern kein Tabu-Thema. In den Schulbüchern waren Fotos der Leichenberge von Bergen-Belsen abgebildet, der massenhafte Mord in den Gaskammern wurde benannt, allerdings weitgehend ohne auf den antisemitischen Hintergrund einzugehen. Stattdessen wurden die Opfer allgemein als „Häftlinge aus allen Ländern Europas“
bezeichnet oder sie wurden ebenso pauschal dem Widerstand zugeschrieben.2
Dora Davidsohn (1913–1999) arbeitete in der Emigration in Frankreich für die Kommunistische Partei. Nach ihrer Flucht aus der Internierung als „feindliche Ausländerin“ schloss sie sich der Résistance an. Mehr über sie und ihren ersten Mann Alfred Benjamin erfahren Sie in einem Video auf unserer Website. Résistance-Armbinde von Dora Benjamin, geb. Davidsohn, Frankreich, ca. 1942–1945; Jüdisches Museum Berlin, Schenkung von Peter Schaul, Foto: Roman März
Das Gedenken an den 9. November 1938 blieb viele Jahre lang vornehmlich auf Veranstaltungen innerhalb der jüdischen Gemeinden beschränkt, meist begleitet von einer kurzen Zeitungsnotiz mit einer Grußbotschaft des SED-Zentralkomitees.
In der ersten Hälfte der 1980er-Jahre jedoch kündigten sich Veränderungen dieses eingespielten Rituals an, deren Höhepunkt schließlich im Jahr 1988 der große offizielle Gedenkaufwand anlässlich des 50. Jahrestags des Pogroms bildete: Die Mitglieder des SED-Politbüros, alle mit Kippot auf den Köpfen, umringt von Fernsehkameras und Blitzlichtern legten Kränze auf dem Jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee nieder, um am folgenden Tag den symbolischen Grundstein für den Wiederaufbau der zerstörten Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße in die Erde zu senken. Ohne Zweifel standen hinter dieser Wende vor allem außenpolitische und ökonomische Interessen im Hinblick auf die Beziehungen der DDR zu den USA. Doch die Staats- und Parteiführung reagierte damit auch auf eine sich verändernde Situation im Innern, wo engagierte Vertreter*innen einer in der DDR aufgewachsenen Generation die antifaschistische Erziehung ernst nahmen und die Ignoranz und Achtlosigkeit gegenüber den Spuren einstigen jüdischen Lebens in ihrem Umfeld nicht mehr hinnehmen wollten. Ihre Initiativen, um zerstörte und verwahrloste Begräbnisstätten wiederherzurichten und/oder lokale jüdische Geschichte zu erforschen, trafen plötzlich in den Behörden auf Interesse und wurden sogar gefördert.
Aufnahme aus der Fotoserie der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße, 1987, Berlin; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Mathias Brauner
Jenseits der Schmalspur der staatlichen Erinnerungspolitik gab es in der DDR allerdings bereits lange vor dem späten Kurswechsel der 1980er-Jahre viele andere Zugänge zur Geschichte des Holocaust. Die Rede ist von Romanen, autobiografischen Berichten, Theaterstücken und Filmen. Exemplarisch sei hier Die Ermittlung von Peter Weiß erwähnt, eine dokumentarische Bühnencollage über den ersten Auschwitz-Prozess in Frankfurt/Main, die am 19. Oktober 1965 in einer Ring-Uraufführung gleichzeitig in fünfzehn west- und ostdeutschen Theatern uraufgeführt wurde. Der weitgehend autobiografische Roman Die Bilder des Zeugen Schattmann des Schriftstellers und Auschwitz-Überlebenden Peter Edel erschien 1969 und lief einige Jahre später auch als Mehrteiler im Fernsehen. 1975 kam der Film Jakob der Lügner in die Kinos und wurde zwei Jahre später sogar für einen Oscar nominiert.
Jüdischsein jenseits der Gemeinden
Ein Text über Jüdinnen*Juden in der DDR kann sich nicht auf die Mitglieder der jüdischen Gemeinden beschränken, sondern muss den Blick ebenso auf die weitaus größere Gruppe der Holocaust-Überlebenden richten, die aus jüdischen Familien stammten, sich jedoch von der Religion und Tradition ihrer Vorfahren entfernt hatten. Viele von ihnen hatten sich bereits vor 1933 der Arbeiterbewegung angeschlossen und waren Mitglieder der KPD geworden. Ihre Loyalität galt der Sowjetischen Besatzungsmacht und der Kommunistischen Partei, in deren Machtbereich sie auf gute Lebens- und Arbeitsbedingungen hoffen konnten.
Sie waren Schriftsteller*innen, Schauspieler*innen und Regisseur*innen, Sänger*innen, Komponist*innen und bildende Künstler*innen. Sie übernahmen die Leitung neugegründeter Verlage, Rundfunkanstalten und Zeitungen, wurden auf Lehrstühle an den Universitäten berufen, wurden Betriebsdirektor*innen oder hatten Funktionen im Partei- und Staatsapparat inne.
Während der Phase der stalinistischen Säuberungen hatten viele von ihnen Vorwürfe, Verdächtigungen und zumindest berufliche Zurücksetzungen hingenommen. Und vielleicht war es gerade die Erfahrung der eigenen Verfolgung während der NS-Zeit, die Trauer um die ermordeten Angehörigen, die sie auf wenig bewusste Weise an das sozialistische Projekt banden. Mit ihrer Kreativität, der fachlichen Kompetenz und Weltläufigkeit spielten diese Frauen und Männer eine wichtige Rolle beim Wiederaufbau des kulturellen Lebens und neuer politischer Strukturen. Zu den Bekanntesten unter ihnen gehörten Anna Seghers, Lea Grundig, Arnold Zweig, Alfred Kantorowicz, Stefan Hermlin, Ernst-Herrmann Meyer, Alexander Abusch, Albert Norden, die Brüder Hanns und Gerhart Eisler.
Als eine Ausnahme-Persönlichkeit galt Jürgen Kuczynski, der sich ebenso als Wissenschaftler wie als Parteisoldat verstand. Nach drei Jahren illegaler Arbeit für die KPD in Deutschland war er 1936 nach Großbritannien emigriert und kehrte 1945 in der Uniform eines Obersten der US-Armee nach Berlin zurück. Einige Jahre später gehörte er zu den Gründern der Akademie der Wissenschaften. Das von ihm geleitete Institut für Wirtschaftsgeschichte war ein Ort, an dem für die Verhältnisse in der DDR relativ frei geforscht werden konnte. Der international angesehene Wissenschaftler gehörte zu den Beratern von Erich Honecker. In der gelenkten DDR-Öffentlichkeit trat er immer wieder mit undogmatischen Ideen und ungewöhnlichen Initiativen hervor.
Eine andere Ausnahme-Persönlichkeit war die Sängerin und Tänzerin Lin Jaldati; aufgewachsen in einer armen jüdischen Familie in Amsterdam, wurde sie 1936 Mitglied der Kommunistischen Partei der Niederlande. Die Überlebende von Auschwitz und Bergen-Belsen siedelte 1952 zusammen mit ihrem Ehemann, dem Pianisten und deutschen Emigranten Eberhard Rebling, in die DDR über. Dort war sie bis in die 1980er-Jahre hinein die einzige Künstlerin, die mit großem Erfolg jiddische Lieder sang.
Haltungen zu Israel
Die SED-Führung zählte eigentlich nur Mitglieder der Gemeinden als Jüdinnen*Juden. Aber zu bestimmten Anlässen bediente sie sich für ihre Propagandazwecke auch der jüdischen Herkunft der vielen „anderen“. Zum Beispiel 1961, als die aus jüdischen Familien stammenden Journalisten Max Kahane, Gerhard Leo und Kurt Goldstein als Sonderkorrespondenten zum Eichmann-Prozess nach Jerusalem entsandt wurden, mit dem speziellen Auftrag, auf die NS-Vergangenheit des Bonner Staatssekretärs Hans Globke aufmerksam zu machen. Im Juni 1967, einen Tag nach dem Beginn des Sechstagekrieges zwischen Israel und den arabischen Nachbarstaaten, beschloss das SED-Politbüro – vermutlich, um möglichen Antisemitismus-Vorwürfen vorzubeugen – „Stellung
nahmen von jüdischen DDR-Bürgern zu ver
öffentlichen, in denen sie ihre Empörung über die Israel-Aggression und das Komplott Israel-Washington-Bonn zum Ausdruck bringen“
sollten.3 Doch wie der damit beauftragte Albert Norden irritiert (oder empört?) an Walter Ulbricht berichtete, lehnten zahlreiche der Angesprochenen ein solches Ansinnen ab. Letztlich gehörte keiner der Unterzeichner der am 9. Juni 1967 im Neuen Deutschland publizierten Erklärung einer jüdischen Gemeinde an. Allerdings wandten sich Gemeindefunktionäre vor allem im Verlauf der 1980er-Jahre zunehmend selbstbewusst gegen antisemitische Entgleisungen in der DDR-Berichterstattung über Israel und den Nahost-Konflikt.
Die israelfeindliche Politik der DDR hatte zur Folge, dass den jüdischen Gemeinden der Kontakt zu internationalen jüdischen Verbänden weitgehend versperrt blieb. Erst 1986 durften Abgesandte des Dachverbandes zum ersten Mal eine Tagung des Jüdischen Weltkongresses in Jerusalem besuchen. Schon zuvor hatten die jüdischen Gemeinden nach Jahren eines eher abgeschotteten Daseins begonnen, ihre Fühler ins „innere Außen“, das heißt, in die DDR-Gesellschaft zu strecken. In Berlin und Leipzig luden sie seit Beginn der 1980er-Jahre regelmäßig zu Konzerten, Lesungen und Vorträgen ein. Etwa zur gleichen Zeit gründeten sich in einigen größeren Städten Arbeitsgemeinschaften für christlich-jüdischen Dialog.
Nachwuchs für die Gemeinden?
In den 1980er-Jahren zählten die jüdischen Gemeinden der DDR insgesamt noch etwa vierhundert Mitglieder. Knapp zweihundert davon gehörten zur Ost-Berliner Gemeinde. Der dortige Vorstand unter der Leitung von Dr. Peter Kirchner unternahm im Jahr 1986 einen ungewöhnlichen Schritt, um den Prozess der Überalterung und Schrumpfung zu stoppen. Er lud viele der mittlerweile erwachsenen „Kinder“ aus den säkularen jüdisch-kommunistischen Familien zu einer Veranstaltung in die Gemeinde ein. Die Resonanz war beeindruckend. Die Initiative traf auf ein gewachsenes Interesse seitens der zweiten Generation, mehr über die eigenen Wurzeln zu erfahren, über Wertvorstellungen, Traditionen und Rituale, von denen sich ihre Eltern oder Großeltern bereits vor langer Zeit abgewandt hatten. Es bildete sich die Gruppe „Wir für uns“, deren Mitglieder durchaus an Gottesdiensten, Festen oder am Hebräisch-Unterricht teilnahmen; doch nur ein kleiner Teil von ihnen entschloss sich in den folgenden Jahren zu einem Eintritt in die Gemeinde. Die Mehrheit wünschte sich eher einen losen Zusammenhalt, Diskussionen, Vorträge, kulturelle Veranstaltungen – im Grunde so etwas wie einen Jüdischen Kulturverein. Der durfte sich jedoch erst im Jahr 1990 gründen. Da war die DDR schon fast am Ende.
Annette Leo, freie Historikerin und Publizistin
Dieser Text ist eine stark gekürzte Fassung ihres Beitrags zum Ausstellungskatalog Ein anderes Land. Jüdisch in der DDR.
Menora, ca. 1975–1989, VEB Wohnraumleuchten Berlin; Jüdisches Museum Berlin, Schenkung Jüdischer Kulturverein Berlin e.V., Foto: Roman März.
- Deutsche Volkszeitung, 1.7.1945, zit. nach Elke Reuter/Detlef Hansel: Das kurze Leben der VVN von 1947 bis 1953, Berlin 1997, S. 80f. Vermutlich handelt es sich um ein Zitat von Ottomar Geschke, des ersten Vorsitzenden des Berliner OdF-Hauptausschusses und späterem Vorsitzenden der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. ↩︎
- Vgl. Stefan Küchler: DDR-Geschichtsbilder. Zur Interpretation des Nationalsozialismus im Geschichtsunterricht der DDR, in: Internationale Schulbuchforschung 1(2000), Bd. 22, S. 42-44. ↩︎
- Protokoll Nr. 7/67 der Politbürositzung am 7.6.1967, Anlage 1; SAPMO, DY 30/J IV2/2/1 117, zit. nach Ulrike Offenberg: „Seid vorsichtig gegen die Machthaber“. Die jüdischen Gemeinden in der SBZ und der DDR 1945 bis 1990, Berlin 1998, S. 201. ↩︎
Zitierempfehlung:
Annette Leo (2023), Beargwöhnt und herausgehoben: Jüdinnen*Juden in der DDR .
URL: www.jmberlin.de/node/10076

Alle Angebote zur Ausstellung Ein anderes Land. Jüdisch in der DDR
Über die Ausstellung
Ein anderes Land. Jüdisch in der DDR – 8. Sep 2023 bis 14. Jan 2024
Publikationen
- Ein anderes Land. Jüdisch in der DDR – Katalog zur Ausstellung, deutsche Ausgabe, 2023
- Another Country. Jewish in the GDR – Katalog zur Ausstellung, englische Ausgabe, 2023
Digitale Angebote
- Stimmen aus der DDR – zwölf filmische Kurzinterviews mit jüdischen Perspektiven auf das Leben und das politische System, 2023
- Komm, wir fliegen übers Brandenburger Tor! – Ein Dokumentarfilm von Esther Zimmering
- Aktuelle Seite: Beargwöhnt und herausgehoben: Jüdinnen*Juden in der DDR – Hintergrundartikel von Annette Leo, 2023
- Jüdisch in der DDR. Ein Roadtrip mit Marion und Lena Brasch – ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Berlin, sechs Folgen, 2023
- Jüdische Lokalgeschichte der DDR – Informationen über die Gemeinden in Dresden, Erfurt, Halle, Leipzig, Magdeburg, Chemnitz und Schwerin auf Jewish Places
- Stadtspaziergang Berlin-Ost – mit Jewish Places von der Neuen Synagoge bis zur koscheren Fleischerei, Schulbeteiligungsprojekt 2022/23
- Soundtrack zur Ausstellung – auf Spotify