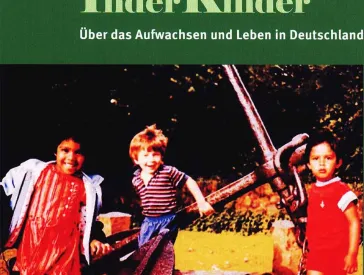„Ich wünsche mir, dass man mir mehr in die Augen schaut als auf das Tuch“
Einige Fragen an Fereshta Ludin
Für das Recht, als Lehrerin mit Kopftuch unterrichten zu dürfen, ist Fereshta Ludin bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen (siehe unten Hintergrundinfo: Bundesverfassungsgerichtsurteile zum Kopftuchverbot). Am 17. September 2015 stellte sie bei im Jüdischen Museum im Rahmen der Reihe Neue deutsche Geschichten ihr Buch Enthüllung der Fereshta Ludin. Die mit dem Kopftuch vor.
Rafiqa Younes und Julia Jürgens haben vorab – am 16. September 2015 – mit ihr gesprochen.
Haben Sie geahnt, dass Ihre erste Klage, die Sie 1998 im Alter von 25 Jahren gegen Ihren Arbeitgeber einreichten, eine bundesweite Debatte über das Kopftuchverbot auslösen würde?
So etwas kann man nicht ahnen, denn ich war noch sehr jung und auch sehr idealistisch. Ich wollte meinen Beruf als Lehrerin ausüben und weder die Öffentlichkeit noch irgendeinen Politiker mit meinem Vorhaben ärgern.
Hat sich aus Ihrer Sicht der lange Weg durch die Instanzen gelohnt, in dessen Verlauf Sie eine öffentliche Person geworden sind – „die mit dem Kopftuch“
, wie der wohl ironisch gemeinte Untertitel Ihres Buches lautet?
Ich bereue keinen Schritt. Vielmehr hätte ich es bereut, Ungerechtigkeiten ertragen zu müssen. Mit dem Gang durch die Instanzen habe ich mich aktiv gegen Diskriminierung eingesetzt. Viele Frauen waren ebenso betroffen wie ich. Eine öffentliche Person zu werden, war dabei nie meine Absicht. Deutschlands Öffentlichkeit hat das Thema ‚Kopftuch‘ auf mich fokussiert und viele gebildete und kompetente Frauen auf ihr Tuch reduziert. Jahrelang. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändert. Das wäre mein Wunsch.
Wie haben Sie die Reaktionen auf die Debatte erlebt: Gab es Unterstützung von Menschen, mit der Sie nicht gerechnet haben? Und gab es andererseits auch Kritik, die Sie überrascht hat?
Kritik gab es immer und fast von allen Seiten, auch von der muslimischen Community. Ich war überrascht, als Politiker*innen den Mut hatten, sich positiv zu der Debatte zu äußern, und sie sich unabhängig davon, was sie selbst zum Thema Kopftuch dachten, für das gleiche Recht auf Arbeit und gegen die Diskriminierung dieser Frauen einsetzten. Das habe ich aber nur bei sehr wenigen bewundern können.
Wie empfinden Sie heute die Situation für Frauen, die in Deutschland ein Kopftuch tragen? Würden Sie sagen, die Atmosphäre in der Öffentlichkeit hat sich geändert?
Die Atmosphäre hat sich politisch geändert. Sie ist nicht mehr so verschlossen und vorurteilshaft, aber es gibt noch viel in der Antidiskriminierungsarbeit zu tun. Aus meiner Sicht ist es entscheidend, sich stärker für die Selbstverständlichkeit von ethnischer, kultureller und religiöser Vielfalt einzusetzen und sie zu fördern. In den letzten 17 Jahren, das heißt seit Beginn der öffentlichen Debatte um das Kopftuch, haben muslimische Frauen einen sehr langen und schweren Weg der Diskriminierung gehen müssen. Das ist vielen nicht klar und wir sollten auch darüber offen reden und reflektieren können.
Cover des Buches Enthüllung der Fereshta Ludin. Die mit dem Kopftuch; Deutscher Levante Verlag
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie, seit Sie sich im Alter von 12 Jahren entschlossen haben, ein Kopftuch zu tragen, immer mit denselben Fragen konfrontiert werden: Ob Sie dazu gezwungen würden, es zu tragen, und ob das Kopftuch nicht ein Symbol der Unterdrückung sei usw.? Welche Frage(n) würden Sie sich stattdessen wünschen?
Ich möchte ungern ständig auf die Gründe eingehen oder mich dafür rechtfertigen müssen, weshalb ich mich persönlich entschieden habe, ein Tuch zu tragen. Jede Frau sollte selbst über ihre Kleidungsweise bestimmen dürfen, auch eine Muslima mit Kopftuch. Es sollte keine Rolle spielen, welche Glaubensüberzeugung der andere hat, wenn er/sie vor einem steht, ob Mann oder Frau. Entscheidend ist, was er/sie sagt, wie er/sie lebt oder handelt. Ich wünsche mir, dass man mir mehr in die Augen schaut als auf das Tuch.
Die Fragen stellten unsere Kolleginnen Julia Jürgens und Rafiqa Younes vom Akademieprogramm zu Migration und Diversität.
Hintergrundinfo:
Bundesverfassungsgerichtsurteile zum Kopftuchverbot
Bundesverfassungsgerichtsurteile zum Kopftuchverbot
Die Lehrerin Fereshta Ludin wurde nach ihrem 1998 erfolgreich abgeschlossenen Referendariat nicht in den baden-württembergischen Schuldienst übernommen, weil sie nicht auf das Tragen ihres Kopftuchs verzichten wollte. Sie klagte sich daraufhin durch alle Instanzen. Am 24. September 2003 erging ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das der Klägerin recht gab und befand, dass „ein Verbot für Lehrkräfte, in Schule und Unterricht ein Kopftuch zu tragen, […] im geltenden Recht des Landes Baden-Württemberg keine hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage“
fände.
Zugleich wurden die Bundesländer auf die Möglichkeit hingewiesen, eine solche Verbotsgrundlage neu zu schaffen. In der Folge erließen acht Bundesländer Gesetze, die das Tragen von religiösen Kleidungsstücken sowie Symbolen im Schuldienst und zum Teil auch in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes untersagen. In fünf Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen sowie dem Saarland) wurden in verschiedener Form Ausnahmen für christlich-abendländische und jüdische Kleidungsstücke und Zeichen formuliert.
Am 27. Januar 2015 hat das Bundesverfassungsgericht in einer neuen Entscheidung ein pauschales Kopftuchverbot für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen für verfassungswidrig erklärt.
Zitierempfehlung:
Julia Jürgens, Rafiqa Younes (2015), „Ich wünsche mir, dass man mir mehr in die Augen schaut als auf das Tuch“. Einige Fragen an Fereshta Ludin.
URL: www.jmberlin.de/node/6345
Interviewreihe: Neue deutsche Geschichten (12)