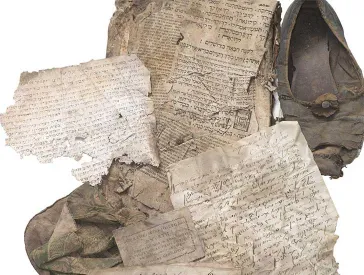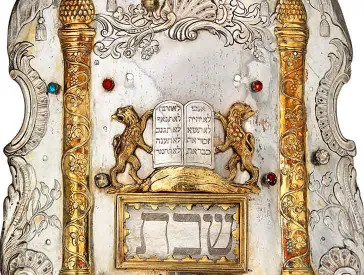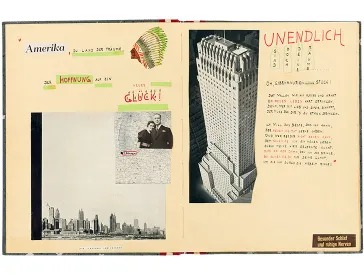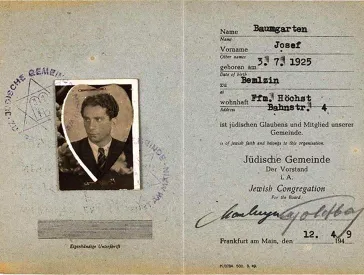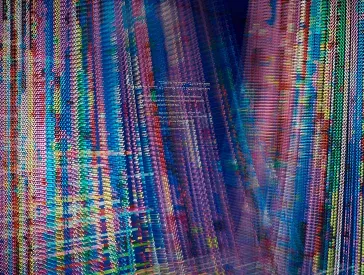Schewirat ha-Kelim (Bruch der Gefäße)
Ungewöhnliche Objekte unserer Dauerausstellung erzählen Geschichten jüdischen Lebens
Anselm Kiefers Werk „Bruch der Gefäße“ interpretiert die Auffassung des Kabbalisten Isaak Luria (1534–1572) von der Katastrophe, die sich während der Schöpfungsgeschichte ereignete:
Schewirat ha-Kelim (Bruch der Gefäße) von Anselm Kiefer (geboren 1945), 1990–2019, Blei, Eisen, Glas, Kupferdraht, Holzkohle und Aquatec; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. L-2019/29/0, Leihgabe von Anselm Kiefer, Foto: Roman März
Um Platz für die Schöpfung zu machen, zog sich der allgegenwärtige Gott (hebräisch En Sof, wörtlich „ohne Ende“) in sich selbst zurück. In den so entstandenen leeren Raum sandte er einen Lichtstrahl, der den eigentlichen Schöpfungsakt einleiten sollte. Zehn Gefäße, hebräisch Sefirot, sinnbildlich für die Harmonie des Universums, sollten diesen Strahl auffangen. Sie konnten den gewaltigen Lichtstrom jedoch nicht fassen, die sieben unteren Gefäße zerbrachen, ihre Scherben vereinten sich mit Funken göttlichen Lichts und fielen in den Abgrund. Der Bruch der Gefäße wird als Symbol für die ins Ungleichgewicht geratene Welt interpretiert, in der das Böse Einzug gehalten hat.
„Kiefer hat hier etwas ganz Entscheidendes im Judentum erfasst, nämlich das Verhältnis von Schrift zur Überlieferung.“ (Peter Schäfer, Judaist)

Was ist die Kabbala? Und wie lässt sich die Welt nach dem Bruch der Gefäße wieder herstellen? Audio aus der JMB App
Text zum Mitlesen: die Kabbala
Die Kabbala ist das komplexe System der jüdischen Mystik. Sie ist eine esoterische Lehre, die sich mit den Geheimnissen der Schöpfung, dem Wesen Gottes und der Aufgabe der Menschen in der Welt befasst. Die Kabbala entstand im Mittelalter in Südfrankreich, Spanien und Palästina. Einer ihrer bedeutendsten Vertreter ist Isaak Luria, der im 16. Jahrhundert in Ägypten und Palästina lebte.
Sein Grundgedanke ist folgender: Gott – hebräisch En Sof, der Unendliche – erfüllt das gesamte Universum. Er ist ohne Begrenzung. Um der Schöpfung Raum zu geben, musste er sich in sich selbst zurückziehen. In den so entstandenen Urraum sandte er Licht, das von zehn Gefäßen aufgefangen werden sollte. Doch das Licht war so stark, dass sieben Gefäße zerbrachen und in den Abgrund stürzten. Daraus entstand die Gegenwelt des Bösen. Der „Bruch der Gefäße“ ist also eine Urkatastrophe im Schöpfungsprozess: Die Welt ist aus den Fugen geraten.
Bei der Wiederherstellung der Welt – hebräisch Tikkun Olam – sind die Menschen gefragt. Durch gute Taten, intensive Frömmigkeit und die Erfüllung der Gebote müssen sie das Gleichgewicht und den Urzustand der Welt wieder herstellen.
Diese Mitverantwortung jedes Einzelnen trug sehr zur Popularität der lurianischen Kabbala bei.
Ausgewählte Werke: Kunst im Jüdischen Museum Berlin (5)
Dauerausstellung: 13 Dinge – 13 Geschichten (13)