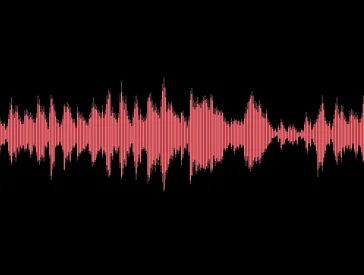Über die Frage, inwieweit das Medium Fotografie ein authentisches Abbild der Wirklichkeit wiedergibt, ist schon viel diskutiert worden. Auch wenn die Fotografie es vermag, das Abgebildete realistisch und scheinbar objektiv darzustellen, verdeutlicht schon allein die Perspektive der Fotografin oder des Fotografen ihre Subjektivität. Sie oder er entscheidet, wann, wo und wie das Betrachtete auf dem Foto erscheint.
Leonard Freed sagt dazu, Zitat, „Was man auf den Bildern sieht, ist das, was ich zeigen wollte“
. Er beschreibt sich nicht als Journalisten, der an eindeutigen Fakten interessiert ist, sondern als Autor und vergleicht seine Fotografien mit Gedichten, deren Bedeutung meist vielschichtig interpretiert werden kann.
1929 in Brooklyn, New York, geboren und aufgewachsen, bereist Leonard Freed schon früh Europa und später Orte auf der ganzen Welt. Zunächst möchte er Maler werden, nach einem Grafikdesignstudium entscheidet er sich dann aber für die Fotografie. Seine Kamera wird zur engen Begleiterin, die ihm hilft, das Erlebte zu verarbeiten und die Welt besser zu verstehen. Ihn interessieren Langzeitstudien, die ihn berühren und jahrelang beschäftigen, oft zu sozialkritischen Themen wie Krieg, Rassismus, Kriminalität, Alter oder Obdachlosigkeit.
Als Kind jüdischer Einwanderer aus Osteuropa nimmt Freed auch immer wieder Jüdinnen und Juden in den Blick. Schon früh fotografiert er die orthodoxe jüdische Gemeinschaft in Williamsburg, ab 1958 entsteht eine umfangreiche Serie über Jüdinnen und Juden in Amsterdam und ab 1961 führt er seine Betrachtungen in Westdeutschland weiter, vor allem in den Gegenden um Frankfurt und Düsseldorf. Er möchte die jüdische Minorität sichtbarer machen und somit der Unwissenheit der Deutschen entgegenwirken.
Er beobachtet immer wieder, dass Deutsche sich nicht mit ihrer jüngeren Vergangenheit auseinandersetzen wollen. Gleichzeitig versucht er mit seiner Kamera sein eigenes Jüdischsein zu ergründen. Zitat, „Der Bedarf, meine Beziehung zum Judentum zu verstehen und zu analysieren und andere Fragen, die mich ratlos machen, führten mich zur Fotografie“
.
Seine Bilder sind skeptisch und hoffnungsvoll zugleich, er gibt wieder, was ihm wichtig ist. Uninszeniert, alltäglich, sensibel und immer nah an den Menschen, die vor seiner Kamera sind.
Auch seine Porträts von bekannten Persönlichkeiten sind keine klassischen Porträts. Auch hier gibt er Situationen und Stimmungen wieder. Er fängt einzelne Momente meist in Nahaufnahmen ein. So steht jedes Motiv für sich und doch ergibt sich aus den einzelnen Aufnahmen ein komplexes Gesamtbild.
Klare Zuordnungen sind ihm zuwider, unperfekte Bilder sind für ihn perfekter, immer geht es ihm um verschiedene Perspektiven.
Aus mehreren tausend Bildern wählt Leonard Freed 52 Motive für das Buch aus, das er 1965 mit dem Titel Deutsche Juden heute veröffentlicht. Die Gestaltung verantwortet der renommierte Designer Willy Fleckhaus.
Mitherausgeber neben Freed ist Hermann Köper. Beiträge von Hermann Kesten, Ludwig Marcuse, Robert Neumann und Alphons Silbermann verbinden die Fotografien kongenial mit eindrücklichen Texten. Zu jedem Motiv schreibt Freed selbst zum Teil sehr ausführliche Bildlegenden.
Die Abfolge der Bilder ist bewusst gewählt. Das allererste Motiv zeigt Marmorbüsten an einer Mauer des alten jüdischen Friedhofs in Frankfurt. Wen sie darstellen, ist nicht bekannt. Auf dem zweiten Motiv ist der jüdische Friedhof in Worms zu sehen, einer der ältesten Europas. Die Motive verdeutlichen den großen Bruch durch die Schoa, aber auch die lange Tradition des Judentums in Deutschland. Ebenso im ersten Bildteil finden sich drei Motive mit direktem Bezug zu Naziverbrechen. Das erste zeigt den Unterarm einer Frau mit einer eintätowierten Nummer des Konzentrationslagers Auschwitz. In einer scheinbar idyllischen Ausflugsszene setzt Freed die Nummer in die Mitte des Bildes. Auf dem zweiten Motiv ist ein Gebetbuch mit eingelegten Fotografien ermordeter Familienangehöriger zu sehen und das dritte trägt den Titel Holzgitter über den Blutgräben im ehemaligen KZ Dachau.
Zum Schluss der Serie richtet Freed seinen Fokus auf junge Menschen, Kinder und Jugendliche. Dieser Abschluss des Buches mit größtenteils offenen und freundlichen Bildern unterstreicht den optimistischen Blick des Fotografen. Seine Bilder zeugen von Empathie, Sensibilität und Ernsthaftigkeit, aber kennen auch humorvolle Details.
Nicht einmal 20 Jahre sind seit dem Ende der Schoa vergangen. Die wenigen jüdischen Gemeinden sind klein. Insgesamt leben um die 25.000 Jüdinnen und Juden in Westdeutschland. Ihre Anwesenheit im Land der Täter ist alles andere als selbstverständlich. Die meisten sind aus Mangel an Alternativen dort und sitzen auf den viel zitierten gepackten Koffern. Auch außerhalb Deutschlands werden sie mit Unverständnis beobachtet und die Mehrheitsgesellschaft ist weiterhin durch Antisemitismus geprägt.
Die Aufarbeitung des Nationalsozialismus kommt nur langsam in Gang. Nach dem Eichmann-Prozess 1961 in Jerusalem braucht es zwei weitere Jahre, bis der Auschwitz-Prozess in Frankfurt stattfindet. Diplomatische Beziehungen zwischen der BRD und Israel werden erst 1965 aufgenommen. Im selben Jahr diskutiert der Bundestag über die Verjährung von NS-Unrecht. Gleichzeitig wünschen sich nicht wenige Bürger und Bürgerinnen einen Schlussstrich. 1966 tagt der Jüdische Weltkongress in Brüssel, um über das Thema, wir haben es schon gehört, Deutsche und Juden – ein ungelöstes Problem zu diskutieren. In Deutschland wäre eine solche Veranstaltung zu dieser Zeit noch undenkbar gewesen und Thomas Sparr wird dazu gleich sprechen.
Es lohnt sich, sich die verschiedenen Biografien und Erfahrungen der Abgebildeten von Leonard Freeds Fotografien zu vergegenwärtigen. Wir nehmen die Ausstellung weiterhin zum Anlass, zu den unterschiedlichen Lebenswegen zu recherchieren und erfahren weiterhin Neues, das wir sukzessive auf unserer Website präsentieren.
Einige Abgebildete möchte ich Ihnen im Folgenden kurz vorstellen. Ihre Biografien zeigen auch unterschiedliche Gründe auf, warum sie sich in Deutschland aufhielten. Dadurch differenziert sich unser Blick und verdeutlicht die Situation von Jüdinnen und Juden in Deutschland in den 1960er Jahren aus unterschiedlichen Perspektiven.
1962 fotografiert Freed Hugo Spiegel. Er war Viehhändler und entstammte aus einer traditionellen jüdischen Familie, die schon seit Jahrhunderten in Westfalen in Warendorf lebte. Nach der Pogromnacht flüchtet er mit seiner Familie nach Brüssel.
1940 wird er festgenommen und deportiert. Seine Frau und sein Sohn, die im Versteck überleben, kommen wenig später nach. Die Tochter Rosa ist in Auschwitz ermordet worden. Sein Sohn Paul Spiegel, der von 2000 bis 2006 Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland war, berichtet in seiner Autobiografie über seinen Vater. Zitat, „In Warendorfs Schützenverein „Hinter den drei Brücken“ wurde mein Vater 1962 Schützenkönig. Zweifellos ein Ereignis mit symbolischem Charakter. Zum ersten Mal wurde ein Jude in Warendorf und im Münsterland und wohl auch in Deutschland Schützenkönig“
. Und er fährt fort: „Ein würdiger König war er, aber kein gedankenloser. Als wir endlich allein waren, sagte er, der nie über die Vergangenheit sprach: ‚Seht ihr, es war richtig heim nach Warendorf zu kehren,‘ und dann, fast verstummt, ‚wenn unser Roselchen das hätte erleben können‘“
.
Ein weiteres Motiv von Leonard Freed zeigt ein junges Mädchen auf dem Schoß ihres Großvaters während einer Bar Mizwa-Feier 1961 in Düsseldorf. Der Vater des Mädchens ist auf einem der anderen Fotos abgebildet. Es handelt sich dabei um Alfred Israel, der 1922 in Leipzig geboren wurde. Die Schoa überlebte er in mehreren Konzentrationslagern und kehrte, wie Hugo Spiegel, nach 1945 wieder an seinen Geburtsort, nach Leipzig, zurück. Nach der Gründung der DDR flüchtet er nach Westberlin. Mit dem Wunsch eigentlich in die USA auszuwandern, strandet er in Düsseldorf und bleibt dort.
Im letzten Bildkapitel mit dem Fokus auf junge Menschen porträtiert Leonard Freed 1961 dieses junge Paar an der Rheinpromenade in Düsseldorf in inniger Pose: Ruth und Herbert Rubinstein. Sie lernen sich dort auf einem Chanukka-Ball kennen und heiraten 1964. Heute haben sie drei Kinder, vier Enkelkinder und zwei Urenkelkinder.
Bis zu ihrem gemeinsamen Leben sind ihre Wege sehr unterschiedlich. Herbert Rubinstein kommt aus Czernowitz in der heutigen Ukraine. Sein Vater wird ermordet, doch er und seine Mutter können überleben. Nach dem Krieg halten sie sich eine Zeit lang in Amsterdam auf und kommen dann nach Düsseldorf.
Ruth Rubinstein wird 1942 in Tel Aviv geboren. Als sie 15 Jahre alt ist, muss sie Israel mit ihrer Schwester und ihren Eltern verlassen. Aus gesundheitlichen Gründen entscheidet der Vater, mit seiner Familie in seine Geburtsstadt Köln zurückzukehren. Ruth Rubinstein kann nicht nachvollziehen, warum sie ausgerechnet nach Deutschland müssen. Sie leidet lange darunter.
Eine ganz andere Ausrichtung erfährt das Leben des hier rechts abgebildeten jungen Mannes, Robby Wachs. Das Bild zeigt ihn als Teil einer Jugendgruppe 1961 in Düsseldorf. Er wird 1947 im hessischen DP-Lager Ziegenhain geboren, das in der Obhut der amerikanischen Besatzungsmacht steht. Die Haltung seiner Eltern beschreibt er folgendermaßen, Zitat, „Nein, in das Land der Mörder, wie meine Mutter damals Deutschland nannte, waren meine Eltern keineswegs geflüchtet, sondern in den Schutzbereich der US-Armee. Zudem sollte es für sie nur eine kurze Zwischenstation sein, denn ihr erträumtes Ziel war Palästina, das verheißene Land Eretz Israel. Damit verband sich ihr ganzes Denken und Streben”.
Auch für Robby Wachs steht fest, dass er Deutschland so schnell wie möglich verlassen will. Zum Sechstagekrieg 1967 reist er nach Israel, um dort zu kämpfen. Danach kehrt er noch einmal kurz nach Düsseldorf zurück, um sein Abitur abzuschließen, um dann endgültig nach Israel zu gehen, wo er bis heute lebt. Im Gegensatz zu Robby Wachs’ Haltung verfolgte die jüdische Gemeinde in Düsseldorf das Ziel, ihre Gemeinschaft stetig zu vergrößern. Robby Wachs erinnert sich, wie er diesem Bestreben bei einer Gemeindesitzung mit den folgenden Worten widersprach, Zitat, „Meine Mutter hat mich nicht geboren, damit ich in Deutschland bleibe“
.
Zum Schluss möchte ich noch einmal zu Leonard Freed zurückkommen. Neben jüdischen Aspekten fotografiert er seit den frühen 1950er-Jahren auch immer wieder andere Motive in Deutschland und führt diese 1970 in dem Buch Made in Germany zusammen. Bemerkenswert sind einzelne kleine Texte am Ende des umfangreichen Bildteils, die mit Trauma 1 bis 4 überschrieben sind und persönliche Geschichten und Erfahrungen Freeds zu Vorurteilen und Antisemitismus wiedergeben. Später schreibt er, Zitat, „Dass ich in den USA geboren bin, gibt mir, so glaube ich, eine eigene, frische Perspektive, durch die mir Dinge auffallen, die der Durchschnittsdeutsche übersieht“
.
Und dies gilt sicherlich auch für seine Fotografien aus der Serie Deutsche Juden heute.
Und jetzt übergebe ich an Thomas Sparr.